Ein Buch und seine Geschichten...
Über Hunde und Menschen und die Macht der Liebe

Maika
Wo mein Platz ist...

Ich fand sie auf einem schmutzigen Parkplatz in Varna - mager, hungrig und verzweifelt. Und ich konnte sie nicht dort lassen.
Varna, Dobrich, Berlin...Stationen einer Reise.

Wo mein Platz ist
War es immer schon so?
Die Straße, der Wind, die Kälte, der Hunger; der Kampf um jedes weggeworfene Stück Brot, den ich verliere, wenn ich nicht schnell genug bin; die Angst wenn die Dunkelheit kommt und ich kein schützendes Loch gefunden habe, das zu klein ist, um die Großen hineinzulassen; die Unsicherheit, ob der Zweibeiner, der sich mir nähert, einen Fußtritt oder ein freundliches Wort für mich hat; die Beklemmung, wenn die riesigen, lärmenden und stinkenden Ungetüme an mir vorbeijagen, die so schnell sind, dass man ihnen nicht entkommen kann - war ich immer schon hier?
Ich weiß, dass ich in die Häuser nicht hinein darf.
Nicht mehr.
Aber irgendwann war ich doch einmal jenseits einer dieser Türen gewesen, hatte einen Platz in einem dieser Häuser, die mir nun verboten sind, war Mitglied in einem Rudel von Zweibeinern, hatte einen Ort zum Schlafen und meistens Futter. Man ließ mich hinaus um die dringenden Bedürfnisse zu erledigen, die man nicht innerhalb seines Lagers verrichtet, und man ließ mich wieder ein, wenn ich zurückkehrte.
Dort war Wärme, Ruhe und Sicherheit. Dort war mein Platz.
Aber dann kam die Zeit, da mich die Männchen zu verfolgen begannen. Sie waren in Scharen hinter mir her und ganz gleich wo ich mich versteckte, sie fanden mich und ganz gleich, wie oft ich sie anfletschte, sie ließen sich nicht verjagen. Wenn ich Glück hatte, gerieten sie meinetwegen in Raufereien, was sie beschäftigte, während ich zu entwischen versuchte.
Aber irgendwann wollte ich nicht mehr davonlaufen oder ich konnte nicht mehr; es war so, als würde der Drang den sie verspürten und der sie hinter mir her trieb, plötzlich auch mich erfassen und daher blieb ich stehen.
Danach kehrte ich zurück an meinen Ort und hatte nun Ruhe vor den Männchen. Dennoch war etwas verändert. Ich wollte viel schlafen und noch mehr fressen und ich wollte die Wärme und Nähe meines Rudels spüren und den Schutz, den es mir gab. Ich wusste, dass ich ihn brauchte, wenn ich auch nicht begriff, welcher Art die Veränderung war, die sich in mir vollzog. Aber auch mein Rudel sah diese Wandlung und es verstand schneller als ich was sie zu bedeuten hatte. Mein Rudelführer wurde zornig und gab mir harte und laute Worte, die mich erbeben ließen, weil ich nicht verstand, wodurch ich sie hervorgerufen hatte. Zum ersten Mal fürchtete ich mich. Die Jungtiere des Rudels kamen und trösteten mich, weil ich verängstigt in einer Ecke saß und mich nicht hervorwagte, und das half mir ein wenig in meinem Kummer; aber mein Rudelführer grollte mir weiterhin und ich spürte seine Ablehnung auch wenn ich sie nicht verstand.
Als ich das nächste Mal von der Verrichtung meines Geschäftes zurückkehrte, blieb die Tür verschlossen. Ich kratzte zaghaft und rief leise, aber niemand ließ mich ein. Ich kratzte wieder und rief lauter und dann noch lauter, doch die Tür blieb zu. Ich blieb sitzen und wartete, denn ich konnte hören, dass mein Rudel auf der anderen Seite war. Doch man holte mich nicht herein. So legte ich mich schließlich auf der Schwelle nieder und wartete, dass die Nacht vergehen und die Tür sich wieder öffnen würde.
Aber sie öffnete sich nicht; nicht für mich. Als sie aufging und mein Rudel heraustrat, um seine eigenen Geschäfte zu verrichten, flitzte ich hinein, voller Hoffnung und vor allem voller Hunger - und wurde sofort am Genick gepackt und wieder hinaus gebracht. Die Jungtiere kamen und hängten sich jammernd an meinen Rudelführer, aber sie hatten nicht die Macht, seinen Sinn zu ändern. Er sprach wieder mit lauter Stimme und als ich auf dem Bauch zu ihm zurückkroch spürte ich zum ersten Mal wie stark die Füße eines Zweibeiners sind und wie weh es tut, wenn sie zutreten.
Der Schreck, aber auch der Schmerz hielten mich davon ab, einen weiteren Versuch zu wagen. Ich blieb liegen, wo ich nach dem Tritt gelandet war; sah hinüber zu der Tür, hinter der mein Heim lag und die nun hinter dem Rudelführer und seinen heulenden Jungtieren zufiel und begriff, dass man mich ausgestoßen hatte.
Ich habe kein Heim mehr, keinen Platz an den ich gehöre, kein Rudel das mich schützt. Ich lebe auf der Straße, suche in den Abfällen nach Nahrung, stets bedrängt von den Großen, die sich gnadenlos durchbeißen und die, auf der Straße geboren und groß geworden, viel besser als ich für diesen Kampf gerüstet sind. Und sie sind auch nicht allein, im Gegensatz zu mir, die man verstoßen hat und die keine Aufnahme in einem bestehenden Rudel finden wird. Meine einzige Hoffnung sind zweibeinige Weibchen, die oft freundlich zu mir sind und mir Brot zuwerfen. Vielleicht gibt es unter ihnen einmal eines, das mich bleiben lässt.
Meine Jungen kamen in einem Loch zur Welt, nach dem ich lange gesucht hatte. Es lag versteckt und war so klein, dass die Großen nicht hineinpassten. In dieser Zeit lernte ich auch, die kleinen, grauen Langschwänze zu jagen, die so flink unter der Erde hin und her rennen und die ungemein nahrhaft sind.
Wenn man sie erwischt.
Ich erwische sie meistens, aber ich muss sehr vorsichtig und auch sehr schnell sein, damit mir meine Beute nicht von den Großen wieder abgenommen wird.
Die Langschwänze und das Brot der zweibeinigen Weibchen hielten mich am Leben, obwohl ich nie wirklich satt wurde. Die Jungen zu säugen kostete mich viel und ich wagte auch nicht, sie zu lange allein zu lassen. Ich begann, mich sehr schwach zu fühlen, was bedeutete, dass ich weder erfolgreich jagen, noch meine Beute, wenn ich sie denn hatte, verteidigen konnte. Als meine Jungen begannen ihre Höhle zu verlassen und die Außenwelt zu erkunden, waren sie in Gefahr, aber ich konnte sie nicht länger beschützen. Ich hatte keine Nahrung mehr für sie und sie mussten lernen, sich allein durchzuschlagen. Ich suchte verstärkt, vor allem wenn die Jungen bei mir waren, die Nähe der zweibeinigen Weibchen, weil ich annahm, sie würden ihnen Futter zuwerfen, was sich auch oft als richtig erwies. So lernten sie, dass Nahrung vor allem durch die Zweibeiner zu erlangen ist; dass aber auch die größte Gefahr von ihnen ausgeht, werden sie nur durch Erfahrungen erkennen können, welche Lektion die schwerste und verwirrendste überhaupt sein wird.
Und vielleicht kann sie nur durch Leiden gelernt werden.

Ich hatte mir geschworen, nie wieder einen Fuß in dieses Land zu setzen und natürlich wurde ich meineidig. Aber immerhin, vier Jahre hatte ich den Schwur gehalten und dass ich jetzt doch wieder hier in Varna landete, hatte nichts mit Urlaubsfreuden zu tun, sondern war rein geschäftlich. Die zweite Auflage meines Buches sollte in Druck gehen und musste korrigiert werden und vor allem wollte ich die Tierheime Dobrich, Schumen und Rousse besuchen, die unser Verein in den letzten beiden Jahren aufgebaut hatte - wobei Rousse an der Donau erst in drei Tagen übernommen werden sollte. Noch war es eine Tötungsstation.
Deshalb war ich hier.
Der Verleger war nicht da; es war überhaupt niemand da. Während Dimitrov, der Erste Vorsitzende, schimpfend gegen Türen hämmerte und schließlich eine verschlafen dreinblickende Jungfrau herausklopfte um einen langen Disput mit ihr zu beginnen, von dem ich kein Wort verstand, wanderte ich auf dem Parkplatz herum, argwöhnisch nach streunenden Hunden Ausschau haltend, die meinen Seelenfrieden gefährden könnten. Aber es lag nur ein junger Schäferhund vor einer Imbissbude, zu der er offenbar gehörte. Er sah mager aus, aber nicht gerade verhungert - dennoch: im Auto befand sich immer Hundefutter und als der junge Bursche wedelnd ankam um mir seine Referenz zu erweisen, gab ich ihm ein paar Hände voll Trockenfutter. Damit hatte ich ihn auf den Fersen. Offenbar war sein Frühstück nicht besonders reichhaltig ausgefallen und er sah eine Chance dieses Manko auszugleichen. Er bekam noch eine Portion und als ich an den Mülltonnen noch eine erbärmlich aussehende Katze entdeckte, holte ich kurzerhand die Tüte aus dem Wagen, mich verfluchend, nicht innwendig sitzen geblieben zu sein.

Als ich die Katze fütterte, sah ich sie kommen; eine kleine weiße Hündin, das Gesicht sauber in zwei Hälften geteilt: Augen und Ohren schwarz, in der Mitte ein weißer Streifen, die Schlappohren weich wie Samt. Durch einen schwarzen Fleck, der auf der Hinterhand prangte und ein paar, über das ansonsten weiße Fell, verstreute schwarze Sprenkel, glich sie in ihrer Färbung einer kleinen Kuh.
Sie kam zögernd näher, was die Katze retirieren ließ, fand noch ein paar Körner Trockenfutter, die sie heißhungrig verschlang, nahm es hin, dass sie offenbar zu spät zu dieser Mahlzeit erschienen war und wandte sich ab um die Abfälle an den Mülltonnen zu untersuchen.
Ihre Wirbelsäule wölbte sich wie ein Brückenbogen und die Flanken waren alarmierend eingefallen; auch die langsamen Bewegungen deuteten darauf hin, dass sie ziemlich geschwächt war - ganz offensichtlich war hier jemand einer ordentlichen Mahlzeit sehr bedürftig, also ging ich ihr nach und streute ein erkleckliches Häufchen Futter vor ihre unsicher arbeitende Nase.
Ich hatte den Wagen noch nicht wieder erreicht, als mich ihr Schmerzensschrei herumfahren ließ, gerade noch sehend wie der Schäferhund sich über das ihr zugedachte Futter hermachte, während sie wie der Blitz unter dem Auto verschwand.
Kein Wunder dass sie so hinüber war! Wenn sie überhaupt Nahrung fand, wurde es ihr wahrscheinlich von den großen Hunden abgejagt, gegen die sie schon körperlich nicht ankam. Und sie sah auch nicht aus wie ein typischer Straßenhund, sondern wie einer, der im Garten mit den Kindern Bällchen werfen spielt, um sich anschließend in Vaters Lieblingssessel zu räkeln. Nur war hier weit und breit kein Garten zu entdecken, von Vaters Sessel ganz zu schweigen. Rings um den Parkplatz ragten sozialistische Plattenbauten in die Höhe, welches Ambiente ausreichen würde selbst rheinische Frohnaturen trübsinnig werden zu lassen.
Ich ging in die Knie und lugte unter das Auto, wo sie zitternd hockte.
„Komm’ Schätzchen!“ sagte ich. „Komm’ her!“ Und sie kam und ich nahm sie hoch, ein federleichtes Bündel, das seinen Kopf müde an meine Schulter legte und ich hielt sie fest und wusste, dass ich sie nicht hier lassen konnte.
Dimitrov kam von seinem Gespräch mit der verschlafenen Jungfrau zurück.
„Der Verleger ist nicht da!“ berichtete er. „Er ist in China! Er kommt erst - was haben Sie da?“
„Einen Notfall!“
Mein letzter Notfall hatte ihm fünf Welpen auf seiner Terrasse beschert, von der Hündin, die anschließend mit acht Welpen bei ihm einzog, gar nicht zu reden, so dass er es wohl als besondere Gunst des Schicksals ansah diesmal nur mit einem Exemplar meiner Notfälle beglückt zu werden.
„Ich weiß dass Dobrich überfüllt ist, aber können wir sie trotzdem mitnehmen?“
In Dobrich saßen 280 Hunde, aber er nickte.
„Sicher. Sie ist klein, sie kann beim nächsten Transport nach Hannover mitgehen. Setzen Sie sie rein. Ihr Verleger kommt erst in einigen Wochen zurück, wir müssen in den nächsten Tagen mit seiner Stellvertreterin wegen der Korrekturen verhandeln. Im Augenblick ist sie auch nicht da. Niemand ist da. Das bringt unseren gesamten Zeitplan durcheinander!“
Er brütete einen Augenblick finster, dann setzte er sich hinter das Steuer und ich die kleine Hündin auf die Laderampe des Tierheim- Pickup, ihr fürsorglich eine neue Portion Futter streuend, dabei von der Erinnerung an fünf mutterlose Welpen gestreift werdend, die vier Jahre zuvor jegliche ihnen verabreichte Nahrung unverdaut wieder von sich gegeben hatten.
Ebenfalls in Dimitrovs Auto.
„Halt’ dich wacker, Schätzchen!“ murmelte ich. „Bitte nicht seekrank werden, wenn’s geht!“
Sie blickte furchtsam zu mir auf, machte aber keine Anstalten, gegen ihre Behandlung protestieren oder gar aus dem Wagen springen zu wollen. Das Futter und ihr Hunger schienen sie zu überzeugen, dass jede Alternative nur schlechter sein konnte.
Sie kauerte sich nieder und begann zu fressen.
Diesmal ungestört.
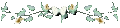
Ich habe lange keine Nahrung mehr gehabt; ich bin zu langsam geworden um die Langschwänze zu fangen, selbst wenn ich sie wittern kann. Es scheint, als wüssten sie, dass ich keine Gefahr mehr für sie bin, so keck laufen sie vor meiner Nase herum, um in ihren Löchern und Nischen zu verschwinden, sobald ich zum Sprung ansetze. Ein Stück Brot wurde mir heute zugeworfen, aber ich war nicht schnell genug. Ein Geflügelter mit starkem Schnabel hat es mir weggeschnappt, zu groß, als dass ich es hätte mit ihm aufnehmen können.
Ich laufe die Straßen entlang, die Nase tief am Boden; ab und zu liegt dort etwas herum, was die Anderen übersehen haben. Ich darf mich nicht zu weit von meinem vertrauten Gebiet entfernen. Wenn ich in ein fremdes Revier eindringe, werden mich die großen Weibchen angreifen. Sie müssen ihre Jungen schützen und jeder der neu kommt ist eine Gefahr für das wenige Futter. Und ich kann keinen Kampf gewinnen. Ich fühle mich schwach und müde. Meine Jungen habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wenn sie zusammenbleiben, kommen sie vielleicht durch. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein zu leben, wir brauchen ein Rudel; nur dann können wir überleben.
Ich habe kein Rudel. Ich bin ausgestoßen.
Ich werde nicht überleben.
Dort drüben liegt der junge Große. Er hat immer Hunger, obwohl ich gesehen habe, dass er Futter bekommt. Aber vielleicht ist es zu wenig; vielleicht würde es für mich reichen, aber ich wage mich nicht in seine Nähe.
Jetzt bekommt er wieder etwas; da ist ein zweibeiniges Weibchen, das ich noch nie gesehen habe und es hat kein Brot, es hat etwas anderes, auf das sich der junge Große stürzt, als wäre er am Verhungern. Ich stehe wie gebannt, aber ich wage nicht hinzugehen, obwohl mir das Wasser aus der Schnauze läuft. Ich warte und hoffe, dass etwas für mich übrig bleibt, aber ich sehe schon, dass es nicht der Fall ist.
Das Weibchen wandert herum, als würde es etwas suchen. Dann entdeckt es einen kleinen Faucher, der auch keine schlechte Mahlzeit wäre, wenn ich es nur mit ihm aufnehmen könnte. Das seltsame Weibchen gibt tatsächlich auch dem Faucher Nahrung und es schickt den jungen Großen weg, weil der Faucher sich nicht herantraut, solange er in der Nähe ist. Das Weibchen scheint ein Alphatier zu sein, wenn es wagt, dem Großen zu befehlen, auch wenn es kein Rudel hinter sich hat.
Ich wollte, es würde mich aufnehmen; ich wünschte, ich hätte genug Mut um hinzugehen und meine Gefolgschaft anzubieten.
Aber es wird mich nicht nehmen. Ich bin ausgestoßen, ich finde keine Aufnahme mehr.
Aber vielleicht bekomme ich etwas von der Nahrung? Ich bewege mich langsam in die Futter-Richtung, vorsichtig spähend, ob der junge Große auf dem Sprung ist. Aber er liegt wieder vor seiner Tür und sieht mich nicht. Dafür sieht mich das Alphaweibchen und ich spüre, dass es freundlich ist. Selbst wenn es kein Futter hätte und auch wenn es merkwürdigerweise einen Faucher füttert - es ist freundlich. Ich schiebe mich hoffnungsvoll näher heran, was den Faucher fauchen und flitzen lässt, und dann bin ich endlich nah genug um zu erkennen, dass nicht viel übrig geblieben ist. Ich fresse hastig die Reste, was gerade ausreicht um meinen Hunger, der sonst nur noch ein dumpfes, lange vertrautes Ziehen im Bauch ist, wütend hervorspringen und übermächtig werden zu lassen. Aber es ist nichts mehr da; vielleicht gibt es bei den Mülltonnen noch etwas zu finden, vielleicht ein zerknülltes Papier, in dem noch ein wenig Wurst oder wenigstens Fett klebt. Vielleicht aber auch nicht. Es wird nicht sehr viel Nahrhaftes weggeworfen in dieser Straße.
Dann steht auf einmal das freundliche Weibchen hinter mir und schüttet einen Berg Nahrung vor mich hin und ich erkenne fassungslos, dass dieser Futterberg offenbar mir allein zugedacht ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen soll, diese Menge schnell genug hinunterzuschlingen, bevor ich Gesellschaft bekomme, aber ich muss es versuchen; aber das Futter ist hart und muss zerbissen und zerkaut werden, ich kann es nicht schlingen, so sehr ich es versuche; es bleibt mir in der Kehle stecken, ich muss würgen um es wieder heraus zu bringen und dann ist auch schon der junge Große da und beißt mich weg. Ich gehe schreiend in Deckung und muss zusehen, wie er mein Futter auffrisst.
Er kann das tun, obwohl er ein Junger ist. Aber er ist stärker und größer als ich und er ist nicht ausgestoßen, so wie ich.
Ich bin schutzlos und er weiß es.
Aber dann geschieht das Unfassbare. Ein Gesicht späht in mein Versteck, eine Stimme lockt mich, eine Hand streckt sich mir entgegen und sie hält ein Stück des Futters, von dem es anscheinend unendliche Mengen gibt.
Sie.
Das Alphaweibchen auf zwei Beinen, das Muttertier, das den jungen Großen zurechtgewiesen hat, die Leitwölfin, die das Futter vom Jagen bringt und vor mich legt -
Sie.

Ich flüchte mich zu ihr, die meine einzige und letzte Hoffnung ist; sie nimmt mich auf und ich befinde mich jählings bedeutend höher als der junge Große und weiß, er wird nicht wagen, mich nochmals anzugreifen; nicht solange sie mich hält. Ich möchte meinen Kopf in ihrem Fell verstecken, aber sie hat keines, was auch einerlei ist, solange sie mich hält und nicht wieder auf die Straße setzt, wo ich wehrlos bin.
Lass’ mich nicht los, lass’ mich bleiben, nimm’ mich auf....
Und halt’ mich fest...
Ich habe keinen Platz mehr in dieser Welt; gib’ mir einen neuen, damit ich wieder weiß, wo ich hingehöre; lass’ mich bleiben, am besten da, wo ich gerade bin; denn da ist Sicherheit.
Sie setzt mich nicht wieder auf die Straße; sie redet mit einem zweibeinigen Männchen, dass von irgendwoher auftaucht und dann setzt sie mich in eines der rollenden Ungetüme, denen ich nicht gewogen bin; aber wenn sie will, dass ich darin sitzen bleibe, dann werde ich es tun, was auch nicht so schlimm ist, denn dort riecht es nach ihr. Unter anderem. Und - oh größte Gnade! - sie gibt mir nochmals Futter und diesmal bin ich ungestört. Ich kann in Ruhe fressen und niemand wird mir etwas wegnehmen. Nicht solange sie da ist.

Fast zwei Jahre habe ich über Dobrich und seine Hunde geschrieben; über die Anfänge, als die alte Tötungsstation aufgelöst und innerhalb von vier Wochen in ein provisorisches Tierheim verwandelt wurde. Über Felix, der zusammengekauert in einer Ecke seines unglaublich schmutzigen, verwahrlosten Zwingers lag, einziger Überlebender der jahrelangen Massaker. Ihn auch noch umzubringen hatte sich wohl nicht mehr gelohnt. Über Gina, die, zum Skelett abgemagert, aus dem Gebüsch auftauchte und sich binnen weniger Wochen zu einer wunderschönen weißen Hündin mauserte; über Roschko und Boschko, die an der Steilküste von St.Konstantin gefunden wurden, zwei halbverhungerte junge Rüden, die so schwach waren, dass sie nicht mehr laufen konnten; über Benny, den dreibeinigen Schäferhund, der eines Morgens im Schnee vor dem Eingang lag; über Rocco, den Rottweiler, von Zigeunern gebracht, ein Schatten nur noch, dessen vereiterter Kiefer seinen Kopf völlig deformiert hatte; und über viele andere mehr.
Es sollte eine Kastrationsstation sein, mit der Option auch Notfälle aufzunehmen, die nicht sofort an ihre alten Futterplätze zurückgebracht werden konnten. Dafür hatte man ursprünglich etwa 80 Plätze vorgesehen. Inzwischen lebten 280 Hunde auf dem Gelände; Kranke, Verletzte, trächtige Hündinnen und Muttertiere mit ihren Welpen. Und Welpen ohne Mütter.
Viele Welpen.
Ich war auf alles vorbereitet. Und trotzdem haute es mich fast um. Ein Hektar umzäuntes Gelände voller Hunde ist kein alltäglicher Anblick. Auch vor dem Zaun lagerten an die zehn Vierbeiner, die sofort das Auto umkreisten und, sich gegenseitig schubsend, ihren Anteil an Streichlern, guten Worten und vor allen Dingen guten Leckerlis, einforderten. Es lag reichlich Trockenfutter herum und sie waren wohlgenährt und ganz offensichtlich nicht hungrig - aber sie wollten Leckerlis.
Links und rechts Trockenfutter verteilend, kämpfte ich mich zur Heckklappe durch, um meinen kleinen Notfall herauszuholen, der auf der Ladefläche saß und hoffnungsvoll wedelte. Ich nahm sie sicherheitshalber auf den Arm und folgte Dimitrov, der seinerseits durch das Hunderudel watete, jeden einzelnen beim Namen nannte und milde Gaben verteilte, zum Tor, hinter der die nächste Meute lauerte.
Zur linken Seite befanden sich drei kleinere Gehege, jedes 15 bis 20 aufgeregte Junghunde beherbergend, im Eingangsbereich lagen, standen oder liefen etwa 20 ausgewachsene Tiere herum, gesäumt von etlichen Welpen, die sich mit Hurra auf alles stürzten, was zum Tor hereinkam, und dahinter sah ich den so genannten großen Auslauf: mindestens 3000 Quadratmeter umzäuntes Gelände, auf dem sich Hütten, Unterstände, ein großes Armeezelt und mindesten 50 sichtbare Hunde befanden, viele davon säuberlich am Zaun aufgereiht, offenbar um jede neue Situation im Auge behalten und kommentieren zu können.
Ich stand da, das weiße Fellbündel an mich gedrückt, sah nichts als glückliche Hunde, die eine Zuflucht gefunden hatten, die einzigartig war in diesem Land, dessen „Tierheime“ ausnahmslos Tötungsstationen waren, in denen unvorstellbares Grauen herrschte, und wo „Erfurcht vor dem Leben“ nicht einmal den Menschen gezollt wurde, geschweige denn den Tieren - und brach in Tränen aus.
Vier Jahre zuvor, als eine kleine schwarze Hündin zu meinen Füßen starb und mir ihre fünf Welpen als Vermächtnis hinterließ, hatte ich ihr und mir ein Versprechen gegeben: für ihre Kinder zu sorgen und dass ihr Tod nicht sinnlos gewesen sein, sondern zu einem Fanal für all ihre Leidensgenossen werden sollte.
Ich wollte ein Tierheim in Bulgarien.
Und jetzt stand ich hier und konnte an nichts als an ein unfassbares Wunder glauben, geboren aus der gemeinsamen Vision von drei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein konnten, dem unerschütterlichem Glauben an eine Aufgabe, die als Verpflichtung gesehen und angegangen wurde, der rastlosen Energie, die gegen alle Widerstände und Rückschläge angekämpft hatte und nicht zuletzt der Hilfe und Mitwirkung vieler gleichgesinnter Tierfreunde, die diesen Traum nicht verrückt sondern unterstützenswert fanden.
Sie alle standen in diesem Augenblick neben mir. Und vielleicht haben sie auch geweint.
Durch die Tür in einer gelbgestrichenen Mauer kam eine schlanke, schwarzhaarige Frau auf mich zu, eine Zigarette im Mundwinkel, links und rechts je einen Hund unter dem Arm, ein etwa sechsjähriges Kind im Schlepptau und lächelte mich strahlend an, soweit dies möglich war, ohne die Zigarette zu verlieren.
Maria.
Maria Velikowa, die über ein Jahr lang gegen die Tötungsstation Dobrich Sturm gelaufen war, nachdem sie, auf der Suche nach einer bestimmten Hündin, die man vor ihrem Haus eingefangen hatte, dort hineingeraten war.
Ihren Brief, in dem sie uns um Hilfe bat, habe ich noch immer fast auswendig im Gedächtnis:
„In zwei Räumen, je 5x5m, waren etwa 70 Hunde eingepfercht, vom Pinscher bis zum osteuropäischen Schäferhund. Die Tiere hatten keinen Platz zum Sitzen, geschweige denn zum Liegen, die Böden waren mit Kot und Urin bedeckt, die Fensterscheiben zerbrochen, die Überdachung undicht. Die Außentemperatur betrug zwischen 10 - und 15 Grad. In einem dritten Zwinger waren Welpen eingesperrt, die nach ihren Müttern im Nachbarkäfig weinten. Die Hunde, auch die Welpen, wurden zweimal wöchentlich mit je 12 kg gemahlenen und gefrorenen Gänsebeinen gefüttert, die, grob zerhackt, über den Maschendraht geworfen wurden. Tiere, von den Eisklumpen getroffen, die vor Schmerzen aufschrieen, wurden von anderen malträtiert. Nur die Größeren versuchten an den Eisbrocken zu nagen, die Kleineren wagten sich nicht heran und kauerten, zu Tode erschöpft und abgemagert, zusammen und zitterten unaufhörlich.
Ich werde niemals diese Augen und den erbärmlichen Zustand dieser Geschöpfe vergessen. Soviel Qual auf einem Platz hatte ich bis dahin nicht gesehen...Meine Worte reichen nicht aus um meine Verzweiflung zu beschreiben...“
Keine zwei Monate, nachdem der Brief beim Verein eingegangen war, existierte die Tötungsstation Dobrich nicht mehr und Bulgariens erstes Tierheim erwachte zum Leben.
Viele glückliche Umstände hatten dazu beigetragen; eine Gemeindeverwaltung, die eine Chance sah, sich einen ungeliebten Kostenfaktor vom Halse zu schaffen und Wählerpunkte zu sammeln; eine Frau, die sich seit jeher für die verelendeten Tiere ihrer Heimatstadt eingesetzt hatte, vertrauenswürdig genug war, um ihr Gelder anzuvertrauen und imstande, das, was sie jahrelang im Kleinen praktiziert hatte nun im Großen zu tun; ein Gelände, groß genug und weit genug von der Stadt entfernt; Gebäude, die zwar sanierungsbedürftig aber benutzbar waren, inklusive Strom- und Wasseranschlüssen; ein fähiger Tierarzt und ein kleines Team begeisterter Helfer. Und zwei Sponsoren, die bereit waren, sowohl die Instandsetzung als auch die monatlichen Fixkosten zu einem guten Teil zu übernehmen. Einer davon ist das Deutsche Tierhilfswerk, (inzwischen umbenannt in "aktion tier" )das nunmehr auch für die Tierheime Schumen und Rousse aufkommt. (Und das nahezu 12 Jahre lang tat, was allein die Tierheime am Leben halten konnte!)
Den Rest haben wir durch Spenden, Mitgliederbeiträge, Hundepatenschaften und den Verkauf von „Misas Stern“ zusammengebracht.
„Hallo!“ sagt Maria und das war’s dann auch schon mit der verständlichen Konversation; der Rest ist bulgarisch und muss von Dimitrov übersetzt werden, was dieser in gebotener Kürze tut: „Sie fragt, wie es Ihnen gefällt!“ erläutert er Marias ausufernde Rede.
„Gr..großartig!“ schniefe ich, immer noch heulend. „Ihr macht das hier ganz toll!“ Das ist ein reichlich lahmes Statement in Anbetracht meiner überkochenden Gefühle, aber Maria strahlt, tätschelt meinen Arm mit dem darin befindlichen Hund und redet unablässig weiter.
„Sie will wissen, wo der kleine Hund herkommt. Ich habe ihr gesagt, dass er mit nach Deutschland geht. Sie will den Namen wissen, damit er auf die richtige Liste kommt.“
„Maika“, sage ich, ohne nachzudenken.
„Sie heißt Maika.“
Und dann überlege ich, wie ich auf diesen Namen komme, der auf Bulgarisch einfach nur „Mama“ bedeutet, wonach sie nicht unbedingt aussieht, sondern eher wie ein kleines Mädchen. Aber der Name klingt wie eine leise Glocke in mir und versetzt mich ein weiteres Mal vier Jahre zurück, in einen Bergwald oberhalb des Goldstrandes, zu einem alten Mann, der mit mir vor seiner Hütte sitzt und von Maika spricht, seiner Hündin, die seit zwei Tagen tot ist und deren Welpen ich in ein anderes Land und in ein anderes Leben mitnehmen werde.
Maika, die ich Misa genannt hatte.
„Hier lang!“ Dimitrov verschwindet hinter der gelben Mauer und ich ziehe hinterher. Eine winzige Person mit Gummistiefeln und schwarzen Ponyfransen, die aussieht wie Gustav Adolfs Page und einen Sack Trockenfutter schleppt, taucht auf und wird als Tanja vorgestellt; ein junges Mädchen mit zweifarbigem Haarschopf und reizendem Lächeln - Lesja - hängt Wäsche auf, während ein schlaksiger Bursche, dem hundert Klimmzüge täglich nicht schaden würden, die Zwinger mit Besen und Schaufel putzt.
Dann erscheint ein beeindruckendes Mannsbild von mindestens 90 Kilo Lebendgewicht, verteilt auf circa 190 Zentimeter Länge, auf der Bildfläche - Dr. Dobrev, unser Tierarzt, der den Anschein erweckt, er sei an weibliche Huldigungen nicht nur gewöhnt, sondern betrachte sie quasi als Geburtsrecht, was in meinem Hirn unweigerlich die Wirkung eines Pheromons mit Diametraleffekt auslöst - was soviel heißen soll, dass meine innere Suffragette an die Oberfläche schnellt wie ein Zelluloidball.
Ich blecke ihn an, was er als Lächeln interpretieren kann oder auch nicht, aber er interessiert sich weitaus mehr für Maika, als für mein Zähnefletschen und beordert mich in den Praxisraum, um sie zu untersuchen. Sie wird geimpft, entwurmt und abgehorcht; dabei stellen wir fest, dass ihr Gesäuge angeschwollen ist, sie also Junge haben muss.
Allmächtiger! Habe ich jetzt Welpen dem Hungertod überlassen? Ich bin drauf und dran stehenden Fußes nach Varna zurück zu hetzen, um nach den Jungen zu fahnden, wenn auch ohne die geringste Ahnung wo ich sie suchen sollte. In Maikas Nähe waren sie jedenfalls nicht, dann hätte ich sie gesehen. Der Doktor untersucht die Zitzen und stellt fest, dass sie keine Milch mehr hat, wenn er auch nicht sagen kann, seit wann nicht mehr. Er bemerkt meine Aufregung und lässt Dimitrov dolmetschen, dass das Gesäuge sich schon zurückgebildet habe, was seiner Meinung nach dafür spricht, dass sie die Welpen bereits vor einiger Zeit abgesetzt haben müsse. Und dann können sie überall und nirgends sein, sofern sie überhaupt überlebt haben.
Er befindet Maika für gesund und somit wird sie zur Ungezieferwäsche freigegeben, wonach sie etwas weißer aussieht als zuvor, aber dafür ein Fell hat, borstig wie ein Igel. Anschließend kommt sie in den Zwinger der Reisehunde, eine quirlige Rasselbande von jungen Rüpeln, die ihr lautstark erklären, was sie von ihrem Eindringen halten, nämlich nichts. Sie drückt sich in eine Ecke, aber es gibt nicht viele Möglichkeiten den Lärmern zu entkommen, die ihr da auf die Pelz rücken.
Ich gehe nochmals in den Zwinger, nehme sie auf den Arm, um ihr eine bessere Position zu verschaffen und setze mich auf einen baufälligen Schemel, bestrebt, den kleinen Krakeelern die Schnauze zu verbieten. Natürlich nutzt es nicht das geringste, aber Maika entspannt sich auf meinem Arm und wird ruhiger; ich bringe sie ins Haus, in dem Schlafboxen stehen, mit alten Matratzen und Decken ausgelegt und nachdem ich ihr versichert habe, am nächsten Tag wieder da zu sein, setze ich sie zu ihren Zellengenossen, von denen keiner größer oder älter ist als sie, ihr also nicht wirklich gefährlich werden können, und verlasse den Zwinger und unser Tierheim.


Ich bin satt zum Umfallen; es liegt immer noch etwas da, aber ich kann nicht mehr fressen. Ich versuche, die Reste zu verstecken, aber der Boden ist zu hart um ein Loch zu graben. Ich lege mich darüber, für den Fall, dass ich Gesellschaft bekommen sollte. Die Schaukelei des rollenden Ungetüms verursacht mir Unbehagen, aber solange wir rollen, wird niemand hier eindringen können. Und ich höre ihre Stimme, spüre ihre Nähe, und ich weiß, dass sie da ist, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Sie hat mich aufgenommen und wenn sie in dem rollenden Ungetüm lebt, dann muss ich eben auch hier leben.
Sie hat mich aufgenommen und ich werde ihr folgen. So lautet das Gesetz.
Niemand von uns muss das lernen. Wir wissen es vom Tag unserer Geburt an, denn nichts ist wichtiger als dieses Wissen, von dem unser Leben abhängt. Das Rudel gibt uns Sicherheit, der Rudelführer sorgt für unsere Nahrung. Wohin er uns führt, dahin werden wir ihm folgen.
So war es immer schon.
Als wir das nächste Mal anhalten höre ich, dass sich da draußen ein großes Rudel tummelt, ein größeres als ich es je zusammen gesehen habe. Es sind freudige Stimmen, die ich höre; so klingt ein Rudel wenn der Anführer mit der Beute von der Jagd zurückkehrt. So klangen meine Jungen, wenn ich heimkam um sie zu säugen. Ich erinnere mich.
Ist da draußen mein neues Rudel? Und was wird geschehen, wenn es mich sieht? Wird es zulassen, dass ich neu hinzukomme? Wird es sich dem Willen der Alphahündin fügen oder wird es sich widersetzen?
Sie kommt um mich zu holen und sie behält mich oben, was mich erleichtert, denn dadurch kommt niemand an mich heran und die anderen begreifen hoffentlich, dass sie mich besonders beschützt. Und ich kann sehen, was ich von unten nicht gesehen hätte: hier gibt es unzählige Rudel und jedes ist riesig. Sie sind von einander getrennt, aber sie können sich sehen und auch beschnuppern. Wenn sie es wollen. Sie sind nicht feindselig und ich rieche auch keine Angst, nur Neugier, Erwartung und Freude über die Ankunft der Zweibeiner, was ich absolut verständlich finde, denn sie verteilen nach allen Seiten Futter.
Mir wird ein bisschen schwach bei der Vorstellung, in ein solch riesiges Rudel hineinzukommen; aber wenn es mir gelingt - und es wird mir gelingen, weil sie es ja offenbar will - dann werde ich nicht mehr schutzlos sein; nicht mit so vielen Gefährten hinter - oder besser neben mir. Fürs erste werde ich diejenige sein, die ganz hinten ist. Ich werde mich nicht streiten. Jede Rangordnung kann sich ändern, alte Rudelmitglieder sterben, junge rücken an ihren Platz. So lautet das Gesetz.
Ich will nicht kämpfen. Ich will nur einen Platz.
Aber zunächst einmal bringt sie mich in einen Raum, in dem es unangenehm riecht: so scharf, dass ich niesen muss, aber auch nach Krankheit und Tod und zum ersten Mal rieche ich auch Angst, was mich erbeben lässt; aber sie ist noch immer bei mir und hält mich, also bleibe ich ruhig, denn weglaufen kann ich ohnehin nicht. Ich werde gestochen, es wird in meine Ohren geleuchtet, ein flache, kalte Scheibe gleitet über mein Fell und man spritzt eine Paste in meine Schnauze und hält sie anschließend zu, damit ich sie hinunterschlucken muss. Dann bin ich wieder draußen, aber nun setzt man mich in einen Bottich mit Wasser und schäumt ein übel riechendes Gebräu in meine Haut. Es reizt meine Nase und ich muss unablässig niesen und diesmal versuche ich doch zu entkommen. Aber sie sind zu zweit; die eine schrubbt mich ab und die andere hält mich eisern fest. Keine Chance.
Als ich endlich aus dem Bottich heraus darf, stinke ich so erbärmlich, dass auch ich selbst keine Freundschaft mit mir schließen würde. Ich schüttele mich so kräftig es nur geht, was zwar das Wasser aus meinem Fell fliegen lässt, nicht aber den üblen Geruch, was meine Aussichten vom übrigen Rudel wohlwollend aufgenommen zu werden gänzlich schrumpfen lässt.
Ich blicke zweifelnd zu meiner Alphahündin auf; ist ihr nicht klar, was sie mir hier angetan hat? Man wird mich hassen, ablehnen, über das ganze Gelände davonjagen, ich habe keinen eigenen Geruch mehr, ich bin noch weniger als nichts!
Aber ihr scheint das nichts auszumachen, was nicht eben für die Qualität ihrer Nase spricht. Wie bringt sie es nur fertig mit derart unzulänglichen Geruchsnerven soviel Beute zu erjagen? Und dass sie dazu in der Lage ist, hat sie ja bewiesen, wenn ich mir auch wirklich nicht vorstellen kann, wie sie es anstellt. Sie nimmt mich wieder hoch, spricht beschwichtigend auf mich ein, steckt mir schon wieder ein Stück Futter zu und bringt mich dann in ein Gehege voller randalierender Jungtiere.
Ich verdrücke mich in eine Ecke um wenigstens den Rücken freizuhaben und starre die johlende Bande, die sich im Halbkreis vor mir aufgebaut hat, verzweifelt an. Weglaufen kann ich nicht, ringsum sind Zäune; das heißt aber auch, dass sie mich nicht wegjagen können, denn ich kann ja nicht hinaus. Aber sie müssen mir natürlich zeigen, dass sie zuerst hier waren und dass, nach dem Gesetz des Rudels, jeder Neue zunächst einmal gründlich niedergebellt werden muss. Hoffentlich tun sie nicht mehr als das; hoffentlich kommen sie nicht auf die Idee eine Rauferei anzufangen, weil sie sich so stark und kräftig fühlen und ich so neu bin und so grässlich rieche! Ich bin müde und würde mich gern irgendwo zusammenrollen und einfach nur schlafen, jetzt, wo ich zum ersten Mal nach unendlich langer Zeit wieder satt bin; und ich habe einen aufregenden Tag hinter mir, ich will einfach keinen Krakeel und keine Rangkämpfe, ich will nur meine Ruhe haben und schlafen!
Und dann ist sie wieder da, nimmt mich erneut hoch und ich finde, hier wäre jetzt ein guter Platz zum ausruhen, wenn ich nur hier liegen bleiben könnte, sicher in ihrem Arm, um meinen Kopf dahin zu legen, wo ich das Schlagen ihres Herzens spüre.
Sie bringt mich ins Haus, in das ich mich nicht hineingewagt hätte, denn Häuser sind mir ja verboten worden, und zeigt mir eine Höhle, in der ein paar warme Decken liegen. Offenbar ist dies kein Haus für Zweibeiner, sondern ausschließlich für uns - eine weitere Außerordentlichkeit an diesem außerordentlichen Platz, die aber erklärt, warum ich hier hinein darf. Ich krieche folgsam in die mir zugewiesene Höhle und bin drauf und dran, auf dieser warmen Decke einzuschlafen; aber da steht sie auf und geht hinaus und meine Angst ohne sie zu sein, ist größer als meine Müdigkeit. Ich laufe hinter ihr her, doch ich komme nur bis zum Zaun. Sie ist schon auf der anderen Seite, gibt mir noch ein paar leise, gute Worte und dann geht sie fort und ich bleibe hier sitzen und warte, dass sie zurückkommt.

Maika sollte an dem Welpentransport, der in zwei Wochen nach Hannover abgehen würde, teilnehmen, um von dort aus dem Tierheim Eschwege überstellt zu werden, das sich bereit erklärt hatte zwanzig Junghunde aufzunehmen. In Ermangelung eines eigenen Tierheimes in Deutschland waren wir auf die Hilfe örtlicher Tierschutzvereine angewiesen, die ihre Pforten für unsere Hunde öffneten; denn eine wesentliche Tatsache war uns beim Aufbau unserer Stationen nicht ausreichend klar gewesen: alle Tiere, die als Welpen oder Junghunde zu uns gekommen oder sogar im Heim geboren waren, konnten nicht mehr auf der Straße überleben. Wir mussten Besitzer für sie finden, ein allerdings aussichtloses Unterfangen im eigenen Land. Die Alternative konnte demzufolge nur Deutschland sein; die andere wäre eine Hundeexplosion in Dobrich gewesen. Also wurden die Sommermonate dazu genutzt, je nachdem welche Tierheime gerade Hundemangel hatten, regelmäßige Transporte mit den Touristen-Charterfliegern zu schicken. Überwiegend waren es Welpen mit ihren Müttern, oder auch jüngere Kleinhunde, in Maikas Größenordnung. Aber es gab auch Notfälle, denen eine Kastrationsstation wie Dobrich nicht helfen konnte.
Der alte, blinde Cockerspaniel, der von einer Tierschützerin aus Sofia gebracht worden war. Flavus und Festina, beide angefahren, beide nicht mehr imstande zu laufen. Leon, schwer verletzt, mit vierundfünfzig Schrotkugeln im Kopf, die ihn ein Auge gekostet hatten. Rex, der Briard, den Dimitrov völlig verelendet in Rousse von der Kette befreit hatte, der sich allerdings, halbwegs erholt, mit jedem Rüden in Dobrich anlegte. Bill und Maggie, jahrelange Kettenhunde. Sie alle waren nie Straßenhunde gewesen, sie hatten kein Revier in das man sie zurückbringen konnte, sondern brauchten dringend neue Familien, die sie in ihrer Heimat nicht finden würden.
Ich erkläre dies so ausführlich, weil ich die Vorbehalte - deren kernigster „haben wir denn nicht selber genug Hunde“ uns ständig wie ein Gewehrlauf unter die Nase gehalten wird - bis zum Abwinken kenne.
Selbstverständlich haben wir Hunde.
Selbstverständlich kann jeder der Welpen putzig findet, seine Hündin zwingen welche zu produzieren. Natürlich muss niemand seine Hunde kastrieren lassen.
Selbstredend dürfen wir unsere Katzen frei herumstreunen lassen, wenn sie rollig werden. Zweifelsohne gibt es in diesem Land ein Gesetz gegen Listenhunde, nachdem jahrzehntelang den Hundekämpfen und ihren perversen Initiatoren tatenlos zugesehen wurde.
Unfraglich sind viele Tierheime voll, großenteils mit den unglücklichen Opfern dieses Augenwischergesetzes.
Aber es gibt auch genügend Tierheime, die nicht unter einer Hundeschwemme leiden, die froh sind über gesunde, gut sozialisierte und kleine Hunde, die sie schnell vermitteln können und die ihnen das Geld bringen, dass sie brauchen um die Alten, Kranken oder Listenhunde über die Runden zu bringen.
Denn von der Hundesteuer werden sie nicht unterhalten. Sie leben von Mitgliederbeiträgen und Spenden. So wie wir.
Aber wir haben nicht die Möglichkeit uns über die Vermittlung unserer Tiere zu finanzieren; wir tragen die Kosten ihrer Überführung, einschließlich aller behördlichen Genehmigungen und erforderlichen Impfungen, aber wir haben keinen Anteil an ihrer Vermittlung.
Update: diese Vermittlungsstrategie führte allerdings geradewegs in die finanzielle Flaute, denn die Kosten für Kastration, Impfung, Entparasitierung und Ausreise wurden allein vom Verein getragen. Inzwischen muss daher - vor allem wenn die Tiere an Privatpersonen abgegeben werden - auch eine Schutzgebühr erhoben werden. Vermittlung an private Adoptanten ist immer ein Risiko, dem ich nicht unbedingt freundlich gegenüber stehe, denn trotz Vorkontrollen passiert es immer wieder, dass Hunde wieder abgegeben werden. Ist ein Tierheim der ursprüngliche Vermittler kann dies für das betreffende Tier ein Segen sein - vorausgesetzt es wird dorthin zurück gebracht und nicht planlos weiter vermittelt. Dies zu verhindern ist allerdings fast unmöglich - trotz entsprechender Vertragsklauseln.
Maika sollte also eigentlich nach Hannover fliegen.
Mir ist immer noch schleierhaft, warum ich plötzlich davon abschwenkte, sondern stattdessen beschloss, sie selbst mitzunehmen und ein neues Zuhause für sie zu suchen. Vielleicht lag es an ihrer hoffnungsvollen Ergebenheit, mit der sie mir, sobald ich im Tierheim aufkreuzte und sie aus dem Zwinger holte in dem sie wartend saß, auf Schritt und Tritt nachlief. Sie hatte mich so offensichtlich zu ihrem Leittier erkoren, dass ich mir wie ein Erzbiest vorkam, nur bei dem Gedanken daran, sie müsste, eingesperrt in einer kleinen Box, im Frachtraum des Fliegers zittern und beben und sich aufs Neue verraten und verlassen fühlen. Denn dass ihr dies widerfahren sein musste, dessen war ich sicher. Sie war so wenig ein Straßenhund wie meine beiden alten Damen, zu Hause auf ihrem Sofa.
Aber mich hätte doch zumindest der Hauch eines Gedankens streifen können, dass ich dies, da ich ja nicht beabsichtigte sie bei mir zu behalten, lediglich in die Zukunft verschieben würde und dass nicht unbedingt davon ausgegangen werden konnte, dass sie die Situation, nur weil sie später stattfinden würde, besser verkraften könnte.
Ich bin sonst eigentlich nicht sonderlich begriffsstutzig. Aber hier hatte ich mir offensichtlich selbst ein Brett vor den Kopf genagelt.
Vielleicht lag es aber auch an Rousse, dass mein Gefühlsleben gänzlich aus den Fugen war.

Rousse an der Donau war Dimitrovs Heimatstadt, die er vor nahezu vierzig Jahren verlassen hatte, um zum Studium nach Deutschland zu gehen. Als dortige Tierschützer mit ihm Verbindung aufnahmen und seine Unterstützung gegen die Tötungen in den staatlichen Tierstationen erbaten, flog er sofort hinunter, um die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung aufzunehmen. Dabei besuchte er auch die Tötungsstation und was er mir davon berichtete, ließ in mir nicht den Wunsch aufkeimen, sie kennen lernen zu wollen. Ich hatte nur einige der Fotos gesehen, die er aufgenommen hatte, um unsere Sponsoren von der Notwendigkeit eines Eingreifens zu überzeugen und ich frage mich noch heute, wie er es ertragen hat, diesem Entsetzen leibhaftig gegenüber zu stehen.
Wahrscheinlich konnte er weil er es musste.
Ich dagegen leide nicht unter Alpträumen und ich war auch nicht bereit sie herauszufordern.
Aber er ließ mir keine Wahl.
„Die Übernahme ist eine offizielle Angelegenheit, mit Regierungsvertretern und Presse und Fernsehen und was weiß ich nicht alles. Sie gehören zum Vorstand und das ist auch offiziell. Und wenn Sie nun schon hier sind müssen Sie auch dabei sein!“
Basta.
Also stehen wir gemeinsam am 7. Oktober 2003 um 12.20 Uhr vor der Tötungsstation Rousse, begleitet von dem künftigen Mitarbeiterteam, einem Rattenschwanz von Behördentigern, sowie muskulösen Jungmännern, die überdimensionale Kameras mit gewaltigen Objektiven schultern, und werden von dem, nunmehr abzulösenden, Personal erwartet, dass aufgereiht vor einem Gebäude steht, dessen Außenanlagen sich in erster Linie durch hoch wucherndes Wildkraut auszeichnen.
Ich sehe einen großen, fensterlosen Wellblechbau, der ebenso gut ein verrotteter Flugzeughangar sein könnte und frage mich, was es hier eigentlich zu übergeben gibt. Das Ganze sieht aus, als sollte es besser schleunigst abgerissen werden. Aber vielleicht soll der alte, weißschnäuzige Schäferhund übergeben werden, der neben dem Eingang an der Kette liegt, wohl mit der Aufgabe betraut, diesen verwahrlosten Komplex, in dem seinesgleichen zu Tausenden umgebracht wurde, vor Dieben zu schützen. Der alte Kerl rappelt sich hoch und wedelt verzweifelt, aber er muss noch warten; hier soll tatsächlich eine Übernahme stattfinden und da fängt man mit den Räumlichkeiten an.
Wir übernehmen drei kleine Räume, davon einer offenbar als Büro, (Inventar: 1 Tisch, 1 Stuhl, 1 Schrank, 1 Waschbecken) der andere als Behandlungsraum, (1 Metalltisch) der dritte als Vorratsraum, (sechs Weißbrote, hart und offensichtlich uralt) dienend.

Der nächste Vorraum versperrt durch eine massive Eisentür, die in Mannshöhe Gitterstäbe aufweist, den Zugang in eine große Halle.
Es ist totenstill, selbst die Menschen, die den Vorraum allmählich füllen, schweigen.
Einige Presseleute machen sich lang und halten ihre Kameras durch die Gitterstäbe; also gibt es da etwas zu sehen; also mache ich mich auch lang, steige auf einen Riegel und halte mich an den Stäben fest.
Und ich sehe.
Ich sehe die riesige, dunkle Halle, fensterlos und nass; ich sehe links und rechts der Wände Verliese, jedes etwa 2 Quadratmeter groß;
und ich sehe an die 12 Hunde, die unmittelbar hinter dem Eisentor stehen und zu mir hinaufsehen - stumm und reglos.
Ich kenne Tierheime. Und ich kenne sie nur laut. Sie sind erfüllt vom Bellen und Kläffen und Jaulen eingesperrter Hunde, die entweder gegen diesen Zustand protestieren oder auf sich aufmerksam machen wollen.
Und ich empfand es immer als nerverzerfetzend.
Hier gibt es keinen Laut mehr, nicht den des Zornes, nicht den des Bittens, nicht einmal mehr den der Klage. Es gibt nur die Stille der Angst, eine zum Greifen fühlbare Not, die Nähe des Todes und die von Schmerz und Elend.
Selbst das Berliner Tierheim wäre mir in diesem Augenblick willkommener, als der Platz an dem ich jetzt stehe, vor diesem eisernen Tor, hinter dem sich lebende Wesen befinden.
Jetzt kenne ich den Unterschied; und jetzt weiß ich, was mich erwartet.
Dies ist kein Tierheim. Dies ist ein KZ.
Irgendjemand schiebt den Riegel hoch; irgendjemand tritt als erster ein. Die stummen Hunde, die hinter dem Tor gewartet haben, weichen ein wenig zurück, flüchten aber nicht.
Die hier stehen sind die, die noch Hoffnung haben; und die noch stehen können.
In den Zwingern liegen die, die nichts mehr haben und nichts mehr können. Sie liegen dort wie verschwommene Schatten, zwei, drei oder vier Hunde, aneinandergedrängt um den letzten Rest ihrer verlöschenden Körperwärme zu teilen, kaum zu erkennen in diesem Dämmerlicht, das nur durch Ritzen hereindringt, dennoch deutlich zeigend, dass es keinen gibt, der nicht zum Skelett abgemagert wäre.
Und doch strahlen sie, noch in all ihrem trostlosen Elend, ihrer Wehrlosigkeit, ihrer ausgemergelten Schwäche und ihrer völligen Verlassenheit, größere Würde aus als die Figuren, die uns erwartet haben, die sich jetzt verunsichert am Eingang herumdrücken, und die, so wünschte ich, für ewig ein Kainsmal tragen sollten.
Ich halte die Kamera vor die Augen und fotografiere wie besessen, als könnte ich die Bilder, die ich sehe, indem ich sie durch die Linse betrachte, von mir fernhalten; aber als ich den vierten Käfig erreicht habe, funktioniert auch das nicht mehr. Ich stopfe den Apparat in die Bauchtasche zurück, damit er meinen flatternden Händen nicht entgleitet, gehe in die Hocke, vergrabe den Kopf in den Armen und weine hilflos, und sehe sie dennoch, die Geschöpfe, die man dort langsam hat verhungern lassen.
Und ich werde sie immer sehen.
Irgendwann komme ich wieder auf die Füße und sehe mich nach Dimitrov um, finde ihn im Gespräch mit einem untersetzten Mann in Schlips und Kragen, und schließe daraus, dass er einer der Bürotiger ist, dessen Konversation sicherlich eine Pause vertragen kann.
Später, auf der Rückfahrt, erfuhr ich, dass ich den verantwortlichen Tierarzt für dieses Asyl vor mir gehabt hatte. Meine Unkenntnis dieser Tatsache war sicherlich ein ebenso großer Segen für ihn als auch für mich.
Hätte es mir jemand gesagt, dann wäre ich in diesem Augenblick ohne Überlegung auf ihn losgegangen.
„Sie brauchen Futter“, erkläre ich Dimitrov. „In welchem Auto ist der Futtersack?“
„In meinem“, sagt Dimitrov. „Aber man hat mir versichert, dass sie heute morgen gefüttert worden seien...“ „Na klar“, sage ich, und denke an die sechs Brote. „ Und wahrscheinlich mit Steaks und Lammkoteletts. Hier steht nicht mal eine Wasserschüssel. Ich will dass sie Futter bekommen und ich will sehen dass sie es bekommen! Jetzt gleich!“ Er gibt mir wortlos den Autoschlüssel und ich marschiere auf eine der trüben Tassen zu, die uns vorhin empfangen haben.
„Los Bubi!“ kommandiere ich, „hilf’ mir den Sack aus dem Auto zu holen!“ Er versteht zwar kein Wort aber den Ton kapiert er sofort. „Da lang! Und Tempo!“
Er wuchtet den 20 Kilo Sack auf die Schulter und stapft Richtung Halle zurück.
„Halt mal!“ sage ich. „der hier zuerst!“ Und damit reiße ich den Sack auf um den alten Kettenhund zu füttern, der bei dem Anblick des Futters fast verrückt wird. Er beginnt zu schreien wie ein Kind und zerrt wie wahnsinnig an seiner Kette, sodass ich ihm die Brekkies nur im hohen Bogen hinwerfen kann, weil er mich umreißen würde, ginge ich näher an ihn heran.
Irgendwo muss ich Schüsseln auftreiben. Und irgendwo muss ich auch Wasser auftreiben; aber das hat noch ein paar Minuten Zeit; zuerst müssen die verhungerten Tiere da drinnen zu fressen bekommen.

Als ich die ersten Futterbrocken hinstreue, bricht Chaos aus. Die Hunde stürzen sich auf das, was auf die Erde fällt, aber auch auf das was ich in der Hand halte und weil der Sack für mich zu schwer und der Bengel zu dämlich ist um ebenfalls Futter zu streuen, bin ich innerhalb von Sekunden bewegungsunfähig von Hunden eingekeilt, ohne an das Futter heranzukommen. Ein Ruf ertönt: „Streut es in einer langen Reihe! Nicht auf einen Haufen! Eine lange Linie!“ Die Anweisung wird offenbar von Dimitrov gedolmetscht und endlich setzen sich etliche der neuen Mitarbeiter in Bewegung, um die Order zu befolgen, worauf die Tiere sich von mir abwenden und den neuen Futterspendern folgen.

Am anderen Ende der Halle befindet sich ein weiteres Tor, das jetzt geöffnet wird; Sonnenlicht fällt herein und auch ein wenig Wärme. Die Hunde, die gefressen haben, bewegen sich langsam auf das Licht zu, treten zögernd über die Schwelle, hinaus ins Freie, laufen im Gänsemarsch um das Gebäude, herum, um sich dann, an der nach Süden gerichteten Längsseite, niederzulassen und still in der Sonne liegen zu bleiben. Immer mehr kommen heraus, eine Karawane der Elenden, und so wie sie in ihren kalten Verliesen zusammengedrängt waren, so liegen sie auch hier beieinander, als würde ihre Bürde leichter, gäben sie einander nicht nur Wärme sondern auch Schutz und Trost.
Ich hake den Kettenhund ab und führe ihn in das schmale Freigehege; er läuft die gesamte Front einmal ab, jeden Artgenossen begrüßend und lässt sich dann ebenfalls an der sonnengewärmten Mauer nieder.
In der Halle steht der Erste Vorsitzende wie auf dem Feldherrnhügel und bellt Anweisungen, die emsig notiert und ausgeführt werden, während ich nach den verbliebenen Hunde schaue; einige liegen noch immer in den Zwingern und rühren sich nicht, beachten auch das Futter nicht, dass man ihnen hingelegt hat. Der neue junge Tierarzt spricht etwas Deutsch, erzählt mir, er habe in Darmstadt ein Praktikum gemacht. Er betrachtet besorgt die apathischen Tiere. „Dehydriert!“ meint er. „ Müssten alle Infusion bekommen!“
Ich denke an den Behandlungsraum, mit dem einzelnen Metalltisch. Hier gibt es keinen Tropf, es gibt überhaupt nichts. Aber immerhin werden jetzt ein paar Eimer Wasser hereingeschleppt und in der Halle verteilt, während andere Helfer Holzpaletten bringen und auf den kalten, nassen Betonfußboden der Zwinger legen, eine erste Maßnahme gegen die Bodenkälte. Auch Decken werden geholt. Dimitrov kommt herüber.
„Ich habe angeordnet, dass die Tür nach draußen nur noch nachts geschlossen werden darf. Ansonsten bleibt sie offen, damit die Hunde rein und raus können wie sie wollen. Die Leute sollen gleich losfahren und noch mehr Decken besorgen und ausreichend Futternäpfe. In Varna gebe ich 50 Hundehütten in Auftrag; wenn man sie mit Stroh auslegt werden die Tiere auch ohne Heizung hier in der Halle den Winter überstehen. Die Decke muss abgehängt werden...“ Er blickt angewidert nach oben. „ Das alles ist nur Schrott, sollte abgerissen werden, keine Heizung, kein Platz für Außengehege, nichts! Aber fürs erste müssen wir sehen was wir tun können. Der medizinische Bedarf...“
„Sagen Sie Gospodin Dimitrov, was Sie brauchen“, empfehle ich dem jungen Tierarzt. Er nickt und beide stecken die Köpfe zusammen.

Mein Blick fällt in einen Zwinger, auf einen Hund, der allein dort liegt und ich trete hinein. Im nächsten Augenblick bin ich wieder draußen und ziehe den Tierarzt am Arm hinein.
Er beugt sich nieder und verharrt einen Moment; dann greift er zu, hebt das Tier hoch und trägt es hinaus in die Sonne, versucht es auf seine Füße zu stellen.
Aber es kann nicht mehr stehen.
Es ist eine Hündin, mit rehbraunem Fell; dies und ihr Kopf, mit den großen, dunklen, wie erloschen blickenden Augen, sind ein leiser Hauch einer einstigen Schönheit, lassen ahnen, was für ein wundervolles Geschöpf sie einmal gewesen sein muss, bevor man sie in ein nasses, kaltes Verlies warf, in das nie ein Strahl der Sonne fiel und dort verhungern und verdursten ließ.
Jetzt ist sie nur noch ein Gerippe, ein erbarmungswürdiges, schuldloses Wesen, das zum letzten Mal die Sonne sieht.
Sie wurde am nächsten Morgen eingeschläfert, nachdem noch der Rat eines weiteren Tierarztes eingeholt worden war.
Ihr Grab liegt auf dem Gelände des Asyls, weil niemand sie der Abdeckerei übergeben wollte.
Man nannte sie Rehli, wegen ihres rehbraunen Fells.

„...Hoffnung vergeht
in der Welt der Nacht
durch fallende Schatten
außerhalb von Zeit und Erinnerung...
Schlaf nun
träume von denen, die vor dir kamen
Sie rufen dich von fernen Ufern...“
(„Into the West“ von Annie Lennox)

Wochen später träumte ich von ihr. Ich war wieder in der dunklen Halle und spürte die Kälte bis ins Mark. Das Tor stand offen und ließ das Sonnenlicht herein und in diesem Zwielicht stand sie. Ich bewegte mich auf sie zu, aber sie sah sich nicht um, sondern entfernte sich, ging hinein in Wärme und Licht, langsam erst, dann schneller und als ich den Eingang erreicht hatte, sah ich, dass sie nicht mehr allein war, sondern dass ein großes Rudel auf sie wartete, sie in ihre Mitte nahm und mit sich fortführte. Ich hörte keinen Laut, wie dies in Träumen häufig der Fall ist, aber ich spürte ihre Freude, als hätte sie mir eine letzte Botschaft gesandt, um mich zu trösten.
Wenn dies das Land hinter dem Regenbogen ist und sie sich nun dort befindet, dann will ich getröstet sein, denn erst in diesem Augenblick konnte ich von ihr Abschied nehmen.
Alle anderen 36 Hunde wurden gerettet,auch Cezar, der alte Schäferhund, starb erst 2009 an gesegneter Altersschwäche.
Ein Zuhause mit eigenem Körbchen fand er nie; aber ich glaube dass er in Rousse ganz zufrieden war. Hunger gab es nie mehr und auch kein trostloses Kettendasein.
Die Zeit des Niedergangs hat er nicht mehr erleben müssen.


Es liegen etwa 250 Kilometer zwischen Rousse und Dobrich; aber zwischen dem Grauen von Rousse und der Hoffnung von Dobrich liegt eine ganze Welt. Und dazwischen befindet sich Schumen.
„Ich werde Ihnen noch Schumen zeigen!“ erklärt Dimitrov auf der Rückfahrt. „Es ist nur ein kurzer Umweg.“
„Es ist spät!“ protestiere ich. „Sie sind heute schon fast 500 Kilometer gefahren, von allem anderen gar nicht zu reden! Sie müssen doch fix und fertig sein! Ich bin’s jedenfalls!“
Aber mit Begriffen wie „fix und fertig“ hat der Erste Vorsitzende nichts am Hut, noch schätzt er Hinweise darauf, dass auch seine Leistungsfähigkeit Grenzen haben könnte.
„Schumen wird Sie wieder aufmuntern“, meint er. „Dann haben Sie nicht mehr nur diese grauenhaften Bilder vor Augen. Auch Schumen war eine Tötungsstation, wenn auch nicht mehr sehr viel davon zu bemerken ist. Und in wenigen Wochen hat sich auch Rousse verändert. Obwohl, “ fügt er düster hinzu, „die äußeren Umstände weniger günstig sind. An diesem Gebäude die Umbauten vorzunehmen, die erforderlich wären, dürfte rausgeworfenes Geld sein, wenn wir nicht zusätzlich Platz für Außengehege bekommen. Eigentlich müsste man ein neues Areal suchen, aber...“
Ja. Das „Aber“ heißt „woher die Mittel nehmen“.
Aber es heißt auch: bis jetzt haben wir es immer geschafft. Stück für Stück.
In Schumen empfängt uns ein unternehmungslustiger, wenn auch schwanzloser Irischer Setter, der Shusha und Svilen, die heute Dienst haben, herausbellt, die herbeieilen um eine kläffende Hundemeute, die lautstark das Revier bewacht, zurück zu scheuchen. Hier ist noch alles im Aufbau, aber man kann sehen, dass es mit Riesenschritten vorangeht. Es gibt eine größere Anzahl von Gebäuden, viel mehr als in Dobrich, in denen offensichtlich mit Hochdruck gemauert, verputzt, verfugt und verlegt wird. Auf dem großen Areal sieht man bereits die Pfosten, die die einzelnen Außengehege markieren, die den Zwingern angegliedert werden sollen. Man zeigt uns stolz die fertige Küche, den OP-Raum, die Isolierstationen und eine Halle, die groß genug ist, um ein Reitturnier darin abhalten zu können. Hier werden die Innenzwinger eingerichtet, die Aufwachstationen und die Mutter-Kind-Gehege. Es rennen schon einige Hunde herum, die wie ihre Betreuer - und eigentlich wie der ganze Ort - Optimismus und Freude ausstrahlen und ich spüre wie diese vergnügte Stimmung, wie Dimitrov es prophezeit hat, die grausigen Bilder aus Rousse und mit ihr meine trüben Gedanken verscheucht, wieder Platz schafft für Hoffnung und Zuversicht.

Mein Rückflug wurde verschoben, von 19.15 Uhr auf 21.20 Uhr, was bedeutet, dass ich einen langen Tag am Goldstrand totzuschlagen habe. Dimitrov ist im Morgengrauen abgeflogen, mit den ersten 20 Hunden im Gepäck, die im Tierheim Hochtaunus Aufnahme und hoffentlich auch bald ein endgültiges Zuhause finden werden. Maika wird jetzt allein im Zwinger sitzen, denn die fidele Junghundegang ist nun auf dem Weg in ein neues Leben.
Man wird sie am späten Nachmittag zu mir ins Hotel bringen, mit einem Umweg über Albena, wo in Dobrich kastrierte Hunde wieder an ihren alten Futterplätzen ausgesetzt werden sollen.
Zeit genug für mich einen stillen Gang in die Vergangenheit zu tun.
Ich mache mich auf um den Ort zu besuchen an dem Misa gelebt hat und gestorben ist.
Die Strandpromenade hat sich in den letzten vier Jahren erheblich verändert, weil fast alle Hotels bombastische Umbauten vorgenommen haben, um sich den Standards und vor allem den Ansprüchen westlicher Touristenindustrie anzupassen. Das kleine Hotel „Berlin“ das uns damals ausquartiert hat, ist nicht wieder zu erkennen, so aufgedonnert sieht es aus. Das „Glarus“, schon damals eines der nobleren Quartiere, hat sich dagegen kaum verändert.
Und dahinter scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
Da ist das Fischrestaurant an der Mole; da drüben die Espressobar; am Strand liegen die großen Hunde, die möglicherweise die Väter der fünf Welpen waren. Dort ist der schmale Grünstreifen, auf dem sie gelegen hat, nachdem die Bimmelbahn sie überfahren hatte. Da ist der große Platz, mit den angrenzenden Remisen; dort, zur Hintertür des „Glarus“ hat man sie zum Sterben hingebracht. Und da drüben, wo es in den Wald hinaufgeht, liegt noch ebenso viel Müll wie damals. (Erstaunlicherweise aber auch nicht mehr, als würde jemand dafür Sorge tragen, dass die Müllmenge immer konstant bleibt.)
Ich hangele mich, wie ehedem, den Abhang hinauf und folge aufs Neue dem Pfad, den ich damals, auf der Suche nach ihr, gegangen bin und kann mich der irrwitzigen Vorstellung nicht erwehren, dass sie dort oben auf mich warten könnte.
Aber als oberhalb des Pfades die Bretterhütte aus den Schatten der Bäume auftaucht, bleibt alles still; kein warnendes Bellen ertönt, kein Schakalkopf mit riesigen Ohren schaut auf mich hinunter und keine schwarzen Pelzbällchen purzeln durcheinander. Und kein alter, zahnloser Mann steckt den Kopf aus seiner baufälligen Hütte um mich fragend anzusehen.
Hier ist niemand mehr.

Und doch...
Ich setze mich auf das wackelige Brett, das Michko als Bank gedient und die Jahre verblüffenderweise überdauert hat, und schaue auf die zweifelhafte Konstruktion der Plattform, auf der die Welpen geboren wurden und die Misas Heim war.
Und da drüben sitzt sie und wendet mir ihren schmalen Kopf zu, bewegt die ausdrucksvollen Ohren, als wolle sie mir mitteilen, dass sie bereit sei, sich alles anzuhören, was ich zu sagen habe.
(Es existiert kein Foto von Misa. Das Bild zeigt ihre Tochter Alkmene, die einzige die ihr bis aufs letzte Haar glich.)
„Deinen Kindern geht es gut“, berichte ich. „Mit Alina und Alkmene hat es Probleme gegeben. Aber nichts wirklich Schlimmes. Es ist alles in Ordnung gekommen. Und es gibt jetzt drei Tierheime. Eines ist ganz neu. Da war eine Hündin... sie müsste vor kurzem bei dir angekommen sein. Vielleicht kannst du dich um sie kümmern. Und da ist noch eine kleine weiße Hündin; ich nehme sie nachher mit. Sie ist mir über den Weg gelaufen wie du damals. Sie hatte Welpen, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich wünschte...aber manchmal läuft es nicht so wie wir es gerne hätten. Ich weiß nicht, wo ich sie hätte suchen sollen. Und Dobrich ist so voll... und täglich kommen neue Notfälle und die Leute dort schinden sich wie verrückt und ich habe das Gefühl, sie versuchen einen Wasserfall mit den Händen aufzuhalten und ich...ich denke, ich müsste viel mehr tun und doch bin ich heilfroh, dass ich dieses Land wieder verlassen und mich hinter meinem Computer verstecken kann... ach Misa, manchmal komme ich mir vor, wie die letzte Pfeife. Jetzt gerade zum Beispiel...“
Sie legt sich in ihre klassische „Anubis-Haltung“ und wendet den Kopf ab, als wollte sie mir höflich zu verstehen geben, dass ihr mein Gejammer auf die Nerven geht.
„Wer auch nur ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt!“ zitiert sie. „Und ,jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.’ Hast du das nicht irgendwann geschrieben?“
„Abgeschrieben“, murmele ich.
„Tatsächlich? Und ,tue den Mund auf für die Stummen und führe die Sache derer, die verlassen sind?’ Auch abgeschrieben?“
„Aus der Bibel!“ flüstere ich geknickt
Ihre unglaublichen Ohren schnellen nach vorn. „Ist es deswegen weniger richtig? Tu’ deinen Mund auf, tu’ was du kannst und versuche, das was du kannst so gut wie möglich zu tun. Ich bin zufrieden mit euch. Gute Arbeit. Ich will sehen, ob ich deinen Neuzugang finde. Es sind ziemlich viele gekommen. Und grüß’ die Kinder!“
Und dann ist sie fort und ich sehe nur noch die baufällige Plattform, inmitten des stillen Waldes, in dem sie einst zu Hause war.
Wo auch immer sie sich jetzt befindet - für mich wird sie immer hier sein.

Um 17.00 Uhr biegt der Tierheim-Pickup um die Ecke und Lesja fährt vor, Maika auf ihrem Schoß sitzend. Lesja zuckt bedauernd die Schultern und gibt per Zeichensprache zu verstehen, dass die Hündin sich offenbar nicht davon hatte überzeugen lassen in einer engen Box sitzen zu bleiben, was mich bedenklich dreinschauen lässt, denn sie wird mehrere Stunden in einer engen Tasche zubringen müssen. Ich habe meine Reisetasche umfunktioniert, kurzerhand ein paar Luftlöcher hinein geschnitten und beabsichtige, sie darin als Handgepäck mit an Bord zu nehmen, inbrünstig betend, dass ich damit durchkomme. Sollte man mir Schwierigkeiten machen, werde ich einen Nervenzusammenbruch erleiden, denn die Tasche ist nicht stabil genug um im Frachtraum standfest Start, Landung oder etwaige Turbulenzen zu überstehen; sie würde umkippen, das arme Tier würde hin und her kugeln und nicht heil - wenn überhaupt - wieder herauskommen. Ich hoffe sie bringt, inklusive Hund, nicht mehr als vier Kilo auf die Waage. Sonst könnte es heikel werden.
Lesja sieht müde aus; sie ist seit dem Morgengrauen, da sie die 20 Hunde aus den Zwingern geholt, in die Boxen gesetzt und zum Flughafen gebracht hat, auf den Beinen. Zurück in Dobrich wartete die Tierheimarbeit auf sie; das Füttern und Versorgen von fast 300 Hunden, viele davon Welpen, viele davon krank und verletzt oder frisch operiert. Am Nachmittag hat sie die Hunde, die wieder freigelassen werden sollen, ins Auto geladen und ist weitere 50 km gefahren, nach Albena und danach hierher. Für jede Strecke braucht sie etwa eine Stunde; sie hat jedes Recht müde zu sein. Wir umarmen uns zum Abschied und ich danke dem Himmel dafür, dass Maria Mitstreiter wie dieses junge Mädchen gefunden hat.
Maika trägt Halsband und Leine aus dem Tierheimfundus und ist sichtlich begeistert, mich wieder zu sehen. Ich beschließe die verbleibende Zeit, bevor ich sie in die Tasche hineinklemmen muss, mit ausgiebigem Laufen zu verbringen; dann ist sie vielleicht anschließend müde und macht ein geruhsames Nickerchen in dem engen Behältnis.
Ich stelle fest, dass sie absolut leinenführig ist, sich gehorsam bei Fuß hält, weder Passanten noch andere Hunde anbellt und sich überhaupt aufführt als käme sie frisch aus dem Benimm-Kurs einer Hundeschule und hätte ihn mit Auszeichnung bestanden.
Lise, mein Rehpinscher, ist ein Alptraum gegen sie. Zumindest was ihre Manieren angeht.
Wir marschieren den Goldstrand hinauf und hinunter; Maika läuft unverdrossen, wenn auch etwas verblüfft, neben mir einher; sie macht ordnungsgemäß eine Pfütze und ein Häufchen - gottlob ein festes, kein Dünnpfiff - bis mir die Füße wehtun; dann laufen wir am Strand weiter, der sich, mit einbrechender Dämmerung, leert. Viel Betrieb gab es ohnehin nicht; ein paar Kinder, die noch Burgen gebaut haben; ein paar Sonnenhungrige, die die letzten Strahlen genießen wollten; ein paar Liebespärchen, die mir entgegengeschlendert kommen.

Dann ist es dunkel und dann geht ein riesiger Vollmond auf.
Wir setzen uns in den Sand, Maika dicht neben mir, und betrachten das beeindruckende Nachtlicht, dass da über dem Meer hängt und unweigerlich Gedanken an Sumsemann und Peterchens Mondfahrt aufkommen lässt.
„Weißt du, kleines Mädchen, “ sage ich versonnen, „in Augenblicken wie diesen möchte ich immer glauben dass die Welt schön ist und dass alles, alles gut wird. Sumsemann kriegt sein Beinchen wieder, der böse Baumfrevler seine Strafe und wir fahren mit dem Schlitten auf der Milchstraße spazieren. Ich wünschte, ich wäre nie erwachsen geworden und hätte nie erfahren müssen, dass Baumfrevler ungestraft ihr Unwesen treiben können und dass es kaum noch Sumsemänner gibt. Und dass die Milchstraße so weit entfernt ist, dass die Sterne, deren Licht ich sehe, längst nicht mehr existieren. Erwachsen werden ist nichts anderes als übelste Desillusionierung, die nur gemein weh tut und ich verstehe durchaus, dass meine Tochter sich strikt weigert ihre Kinderschühlein auszuziehen, außer, sie möchte sich die Nacht in einer Disco um die Ohren schlagen. Du wirst sie übrigens in ein paar Stunden kennen lernen. Sie wird dir gefallen, denke ich. Ein wirklich gutes Mädchen, solange man nicht von ihr verlangt sich die zarten Hände mit Hausarbeit zu ruinieren. Aber das wirst du wohl kaum tun, also werdet ihr bestens miteinander auskommen. Ach je!“
Mein Stoßseufzer veranlasst Maika ihren Kopf in meinen Schoß zu legen und meine Hände, die ihre Samtohren streicheln, mit ihrer kleinen feuchten Zunge abzuschlecken, als wollte sie erklären, dass sie zwar für dieses spezielle Problem keine Lösung parat habe, ansonsten aber bereit sei allen Trost zu spenden, den sie geben könne.
Es wird Zeit ins Hotel zurückzukehren und den Hund in der Reisetasche zu verstauen. Maika ist willig, wenn auch wenig begeistert; und die Tasche ist zu klein. Die Luftlöcher hätte ich mir sparen können, denn sie macht keine Anstalten, sich hinzulegen und zur Gänze abzutauchen. Das Äußerste was ich ihr abringen kann ist Sitzhaltung. Ich verknote ihre Leine mit den Griffen, ziehe den Reißverschluss zu, soweit es geht und sichere ihn mit diversen Sicherheitsnadeln, sodass das Ganze aussieht, als wäre der Tasche ein Hundekopf gewachsen. Der Rest des Hundes ist fest verzurrt.
Die Fahrt im Taxi übersteht sie ohne Probleme und am Abfertigungsschalter akzeptiert man sie als Handgepäck - 4 Kilo und 200 Gramm. Mit poltern etliche Steinschläge vom Herzen, während ich sie auf das Rollband setze, damit sie, samt meiner Bauchtasche, nach Waffen durchleuchtet wird. Ich bin so durchgedreht, dass ich schon im DutyFree- Shop angelangt bin, ehe mir auffällt, dass ich zwar die Hundetasche gegriffen habe, nicht aber die Bauchtasche, die, Papiere, Tickets, Scheckkarten, Bargeld und Schlüssel beinhaltend, einsam am Rande des Rollbandes liegt und meiner harrt, die ich hektisch herangestürzt komme, mit Nerven so dünn wie Seidenpapier.
Aber zumindest die schlimmste Hürde ist genommen: sie muss nicht in den Frachtraum.
Die zweitschlimmste wartet in Schönefeld.

Heute Nacht ist das Rudel der Jungen abgeholt worden; ich hatte mich versteckt und als ich wieder hervorkam waren alle fort. Im Nachbarzwinger saßen noch die alten Hündinnen, die dauernd in den Raum müssen, wo es so entsetzlich stinkt und wo das große Männchen im grünen Kittel sich um sie kümmert. Ich blieb den ganzen Tag allein und als endlich eines der zweibeinigen jungen Weibchen kam, vergaß ich, mich zu verstecken, weil ich mich freute, dass überhaupt jemand kam. Und dann holte sie mich heraus, steckte mich in eine Schachtel und stellte mich in das rollende Ungetüm. Und als ich die anderen Schachteln sah, in denen mehrere von uns saßen, wusste ich, dass man mich jetzt fortbringen, dass ich nie mehr hierher zurückkommen und dass ich mein Alphaweibchen nie wieder sehen würde. Die anderen, die man auf diese Weise fortgebracht hat, sind auch nicht zurückgekehrt. Und da begann ich laut zu schreien und hörte nicht auf bis das junge Weibchen zu mir kam und mich aus der Schachtel herausholte. Sie brachte mich zwar nicht in meinen Käfig zurück, aber ich durfte vorne bei ihr sitzen, was mich ein wenig beruhigte.
Wir rollten lange und als sie endlich anhielt, holte sie die Schachteln mit den anderen heraus, öffnete sie und scheuchte sie hinaus. Sie standen unsicher da und witterten. Dann setzten sie sich langsam in Bewegung. Einige wollten wieder ins rollende Ungetüm springen, aber sie durften nicht. Sie mussten zurück auf die Straße.
Sie kam zu mir zurück und ich zitterte vor Angst, dass sie nun mich hinausjagen würde, dass ich aufs neue würde verstoßen werden, wieder herumirren müsste, mit langem Suchen nach Nahrung, ohne Schutz und Hoffnung, an einem Ort, den ich nicht einmal kannte, und ich versteckte mich unter einem Sitz und knurrte sie an. Aber sie sprach freundlich zu mir, setzte sich hin, ließ das Ungetüm aufheulen und weiterrollen. Ich kroch zu ihr und bat um Verzeihung für mein Knurren, erklärte ihr meine Angst und bettelte sie an, mich nicht hinauszujagen. Ich weiß nicht, ob sie mich verstanden hat; aber sie hat meine Ohren gestreichelt.
Dann hielt sie wieder an und öffnete die Tür und alle Last fiel von mir ab, denn draußen stand meine Alphahündin und steckte den Kopf herein. Sie rief mich und ich sprang sie an und wurde von ihr aufgefangen und die grässliche Furcht verließ mich, weil ich wieder bei ihr war.
Ich war hungrig, denn meine Mahlzeit lag lange zurück; sie aber hatte beschlossen lange Strecken mit mir zu laufen; erst die Straße auf und ab und dann durch den Sand, entlang an einem großen, rauschenden Wasser. Zwischendurch gab sie mir zu trinken, was ich dankbar aufschlappte, aber sie hatte nichts Fressbares dabei. Offenbar hatte sie heute keinen Erfolg bei der Jagd gehabt. Da kann man nichts machen.
Als sie mich in eine andere, enge Schachtel zwängte, gefiel es mir nicht; aber sie bestand darauf, dass ich darin bleiben sollte. Also werde ich gehorchen.
Wir sind mit einem anderen rollenden Ungetüm gefahren, aber sie war die ganze Zeit neben mir, ihre Hand auf meinem Kopf. Also muss es so sein.
Dann waren wir in einer riesigen, gleißend hellen Halle, mit unendlich vielen Zweibeinern und ich wurde getragen, dann wieder geschoben und gezogen und alle Geräusche und Gerüche waren fremd und verwirrend; aber ich blieb ruhig, auch wenn mein Herz pochte; sie war ja da und offenbar kannte sie sich in diesem Revier aus und wurde hier geduldet. Zumindest gab es keine Anzeichen für irgendwelche Rudelkämpfe. Nur von weitem hörte ich fernes, höchst beunruhigendes Dröhnen, ähnlich dem, das auf die hellen Blitze folgt, bei heftigem Regen, wenn jeder froh ist, in einer einigermaßen trockenen Höhle zu sitzen - es war ähnlich und doch wieder ganz anders. Meine Lage war sehr unbequem, aber hinlegen konnte ich mich nicht; denn dann hätte ich nichts mehr gesehen. Also blieb ich in dieser ungemütlichen und reichlich anstrengenden Hockstellung und hoffte, sie würde mich baldigst wieder daraus befreien. Aber das tat sie nicht. Sie schleppte mich weiter über lange Gänge und zugige Treppen, hinaus ins Freie, wo das Dröhnen urplötzlich zu einem Höllenlärm anschwoll, und dann wieder in ein rollendes Ungetüm und von da in ein noch viel größeres Ungetüm, das aber noch stillstand. Und auch hier durfte ich nicht heraus. Sie stellte mich zu ihren Füßen nieder und als ich versuchte mein Gefängnis zu verlassen, verbot sie es mir. Also muss ich hier hocken bleiben. Ich bin müde und die Augen fallen mir zu. Vielleicht kann ich schlafen, auch wenn es nicht gerade bequem ist. Aber sie ist hier, ich spüre ihre Hand in meinem Fell, die mich nicht los lässt.
Und solange sie mich nicht los lässt, bin ich sicher.
Und dann beginnt das riesige Ungetüm, in dessen Bauch ich sitze, zu donnern und zu rasen.


Man hat mir einen Sitzplatz in der ersten Reihe gegeben, allerdings am Gang, nicht am Fenster, was bedeutet, dass Maika zu meinen Füßen jeden, der auf seinen hinteren Platz will, behindern würde. Der Fensterplatz ist frei, also nehme ich ihn kurzerhand in Beschlag, hoffend, dass der Eigner ein Einsehen hat und ihn mir überlässt. Kurz bevor die Türen geschlossen werden hastet eine junge Frau, die mir vage bekannt vorkommt und die wild mit der Stewardess diskutiert, durch den Gang - mein Fensterplatz-Passagier. Sie erweckt den Eindruck, als befände sie sich nervlich am Rande des Universums und mein Anblick sei der von Captain Kirk, der auf der Enterprise zu ihrer Rettung heranbraust.
„Oh ja!“ kräht sie. „Die Frau kenne ich! Bitte lassen Sie mich dahin! Ich will neben ihr sitzen!“
„Das ist ohnehin Ihr Platz!“ erklärt die Stewardess, mit deutlich erkennbarer Missbilligung. „Madame, Sie sitzen falsch. Der Fensterplatz gehört dieser Dame!“
Ich öffne den Mund um mein Anliegen zu erklären, aber es gelingt mir nicht, mehr als das zu tun, weil meine Nachbarin in spe bereits großzügig erklärt, dass ihr das völlig piepe sei, ich solle sitzen bleiben, draußen sei es eh stockfinster, da brauche sie keinen Fensterplatz, aber was sie brauche und zwar dringend und sofort und auf der Stelle, dass sei ein Glas Sekt, nein bitte zwei, für mich natürlich auch, denn wenn unser Wiedersehen kein Grund zum Feiern wäre, dann wüsste sie nicht was sonst einer sein könnte und ich wäre ja nicht imstande mir vorzustellen, wie froh und erleichtert und ausnehmend glücklich sie sei, mich wieder zu sehen und was für eine höllische Woche sie hinter sich habe.
Und damit sitzt sie neben mir.
Ich blinzele sie etwas benommen an, überlegend, wie viel Sekt sie schon intus hat. Aber richtig: ich habe sie tatsächlich bereits auf dem Hinflug kennen gelernt, in der Abflughalle. Sie saß da, mit einer Plastiktüte voller Schokolade, die sie mir unbedingt schenken wollte und geriet in einen kompletten seelischen Ausnahmezustand, als sie mir erzählte, ihr Reiseziel sei der Sonnenstrand und ich verblüfft fragte, weshalb sie dann nach Varna statt nach Burgas fliegen würde? Da sie keine Ahnung von den geografischen Gegebenheiten hatte und Varna ihr so unbekannt wie Burgas war, von der Entfernung zwischen beiden Städten ganz zu schweigen, geriet sie in so ernste Bestürzung, dass ich hastig ein paar Möglichkeiten aus dem Hut zauberte, die sie beruhigen und die Umstände ihres Zielhafens erklärlich machen sollten. Ich war mir aber nicht sicher gewesen, ob sie tatsächlich den Flieger bestiegen hatte.
Nun, offenbar hatte sie.
„Sie glauben es nicht!“ verkündet sie. „ Sie hatten Recht! Der Sonnenstrand ist nicht in Varna!“
Und ob ich das glaube.
„Man hat mich im Taxi dorthin gebracht! Im Taxi! Wissen Sie, wie lange ich unterwegs war?“
Etliche Stunden, würde ich mal vermuten.
„Stunden! Fünf oder sechs Stunden! Ich war erst am Morgen da, völlig fertig! Und dann das Hotel! Schimmel! Schimmel und Kakerlaken! Das Essen war grauenhaft, der reinste Schlangenfraß, die Wände so dünn wie Papier und das Wetter konnte man auch vergessen! Ich dachte, ich bin im Süden und könnte noch baden, aber üüüberhaupt keine Rede davon! Sturm und Regen, die halbe Zeit. Wissen Sie - ach kann ich nicht du sagen, diese Förmlichkeiten gehen mir immer so auf die Nerven, ich heiße Karen - ich wollte eigentlich abtauchen, einfach mal eine Woche Auszeit nehmen, das letzte halbe Jahr war extrem stressig, Mobbing auf der Arbeit, eine Scheidung, mein Ex-Mann hat mein ganzes Geld durchgebracht und mit meinem Scheidungsanwalt bin ich jetzt liiert - nicht etwa dass das stressig wäre, natürlich nicht, ich bin ungeheuer glücklich - oh, unser Sekt, auf das Wohl unserer Männer!“
Häh?
„Was ist denn das da unten? Ein Hund? Ach wie süß! Beißt er? Komisch, da unten habe ich überhaupt keine Hunde gesehen. Ich war eigentlich ständig shoppen, einkaufen kann man ja hier wirklich super. Und so billig! Vor allem die Frotteeware ist extrem toll. Ich habe fünf große Handtücher gekauft...“ und damit taucht sie ab und fördert aus ihrem Prada-Bag ein dickes Badetuch im Dschungel-Design zutage... „das habe ich nicht mehr in den Koffer bekommen - und schau mal, hier“, und damit hält sie mir ihr Handgelenk, behängt mit einer Vielzahl von klappernden, klimpernden und klirrenden Armreifen und -bändern vor das zurückweichende Gesicht. „Süß nicht wahr? Das war ein kleines Trostpflaster für das schauerliche Hotel! Gestern Nacht bin ich da ausgezogen, ich hab's nicht mehr ausgehalten, ich hab mir eine Pension gesucht, fünf Lewa die Übernachtung und was glaubst du wohl, passiert mir da?“
Feuersbrunst, Erdbeben, Flutwelle?
„Morgens gegen vier kommt ein besoffenes Pärchen da rein, schmeißt sich in das andere Bett und macht Sex!“
„Waaas????“
„Stark was?“
Sie ist offenbar befriedigt von meiner Reaktion und fährt ermutigt fort. „Ja, die vermieten da nicht die Zimmer, sondern die Betten und ich hatte ein Doppelzimmer, aber nur ein Bett bezahlt. Das war wohl so eine Art Stundenhotel.“
Scheint nicht nur „eine Art“ gewesen zu sein.
„Das wusste ich natürlich nicht. Es war einfach unglaublich. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt mitgekriegt haben, dass sie nicht allein im Zimmer waren, oder ob es ihnen egal war, jedenfalls ging das stundenlang. Ich konnte natürlich nicht mehr schlafen, hab mir zwar die Decke über das Gesicht gezogen, aber das hat ja nicht geholfen. Gegen Morgen sind die dann weg und den Rest des Tages bin ich dann so durch die Märkte gelaufen und hab das restliche Geld ausgegeben. Also erholsam war das sicher nicht, dabei wollte ich so gern alles abschalten; weißt du, auf der Arbeit habe ich echt Probleme – sag’ mal, glaubst du, dass jemand richtig vom bösen Geist besessen sein kann?“
Wen meint sie? Sich oder mich?
„Ich glaube, meine Kollegin hat den bösen Blick, oder sie hat einen Fluch gegen mich losgelassen...“
Inzwischen habe ich das dringende Bedürfnis, das flauschige Dschungel-Handtuch zu ergreifen und seiner Besitzerin fest um den Kopf zu wickeln und nicht zu vergessen ihr die Enden in den Mund zu stopfen. Wir sind schon halb in Berlin und ich habe kaum den Start mitbekommen, weil ich vornüber gebeugt sitze, um den zitternden Hund durch unablässiges Streicheln zu beruhigen, während mir dieses skurrile Geschöpf auf dem Nebensitz, dass ich unter anderen Umständen vielleicht sogar höchst amüsant gefunden hätte, das Gehirn wegbläst mit seinen Geschichten, die sich anhören wie aus einer Vorabend- Sitcom; besser gesagt, aus mehreren.
Aber ich kann ja nicht weg; vor mir sitzt Maika, neben mir ist das Bullauge und unter mir jede Menge dünne Luft.
Und sie plätschert unaufhörlich weiter und auch der gereichte Imbiss bringt sie nicht zum Verstummen. Aber sie gibt Maika immerhin von ihrer Salami ab, meinem Beispiel folgend, dem armen Tier, dem sicherlich höllisch der Magen knurrt, wenigstens eine geringfügige Atzung zuteil werden lassend.
Die Kleine hält sich wacker, fiept nicht, jault nicht und kotzt auch nicht.
Dass Letzteres passieren könnte, hatte mir die größten Sorgen bereitet, meiner Erinnerungen an Misas fünf Kinder eingedenk, die ich am Ende ihrer ersten und letzten Flugreise in nicht eben salonfähigem Zustand aus ihrer Box geholt hatte. Aber Maika ist seefest.
Der Pilot gibt bekannt, dass wir uns über Budapest befinden und meine Reisegefährtin wünscht dringend ein Foto der nächtlichen Stadt aus der Vogelperspektive zu machen, welche Aufgabe sie mir überträgt, weil ich ja ihren Fensterplatz belegt habe.
Ich verkneife mir jede Bemerkung, dass das Ergebnis ihr wohl kaum Freude bereiten wird, sondern halte brav die Digitalkamera ans Bullauge und drücke mehrmals den Auslöser, während sie meinem Rücken erzählt, was für ein übler Scheich ihr Exgatte sei und wie es mit dem Scheidungsanwalt urplötzlich geschnackelt habe und dass es nichts Inspirierendes gäbe, als eine neue Liebe. Sie will wissen, ob ich das nicht genauso sehe und anstatt ein ebenso unverbindliches wie unverständliches „ghrsghilngzrihhosgx!“ von mir zu geben, entgegne ich wahrheitsgemäß ich hätte schon seit längerem keine neue Liebe mehr von innen gesehen, was sie Mutmaßungen über die Gründe dafür anstellen lässt.
Als Resultat ihrer Überlegungen empfiehlt sie mir teilnahmsvoll eine neue Frisur.
Hier hat sie allerdings auf eine gänzlich falsche, weil äußerst schmerzhafte Stelle gepickt; ich wende mich ihr voll zu, betrachte ihre honigblonde, wallende Lockenpracht, vergleiche sie mit meinem unaufhaltsam dünner werdenden Haartuff, der traurig schlaff um mein zwanzig Jahre älteres Gesicht strähnt und frage sie sanft nach ihrem Friseur. Mein Blick jedoch scheint sowohl der Sanftheit wie auch jeglicher Herzlichkeit zu entbehren, denn sie verstummt erstaunlicherweise und nestelt an ihren Armbändern. Ich reiche ihr die Kamera zurück und teile mit, dass ich Anzeichen von Reiseübelkeit verspüre und mich dringend in Meditation begeben müsse, sonst könne ich für nichts garantieren.
Das versteht sie. Und ich habe endlich Ruhe.

Ich sollte tatsächlich meditieren oder zumindest beten, denn wir nähern uns Schönefeld und dort lauern Zollbeamte, denen es einfallen könnte, Maika in Quarantäne zu stecken, bis der Amtstierarzt sie begutachtet hat. Zwar habe ich die Ausreisepapiere und einen gültigen Impfpass, nebst einem Schreiben von Frau Dimitrov, die eigens mit einem Berliner Veterinäramt telefoniert hatte, einer Frau Doktor Sowieso, die ihr ausdrücklich versichert hat, dass der Hund mit den angegebenen Papieren, sofern sie gültig seien, einreisen dürfe.
Aber ich gebe keinen Pfifferling darauf. Bislang hat jeder Hund, ob von mir oder Frau Semmler mitgebracht, den Amtstierarzt passieren müssen; und der ist Sonntagabend um 23.10 Uhr keinesfalls vor Ort, noch wird er sich bereit finden wegen eines kleinen Hundes aus Eichwalde anzureisen. Und eines preußischen Beamten Vorschriften sind heilige Hühner.
Es besteht also durchaus die Gefahr, dass Maika vorübergehend konfisziert wird und als ich die Ankunftshalle betrete, leide ich unter weichen Knien sowie Herzrasen und wünsche innigst, sie würde endlich müde genug sein, um auf Tauchstation zu gehen. Aber natürlich tut sie das nicht. Ihr Kopf ragt aus der Tasche, weithin sichtbar und löst Reaktionen aus wie: „Ach wie niedlich, schau doch mal!“ und: „Na, da hat aber jemand einen Hauptgewinn gemacht!“ wobei unklar bleibt, wer von uns beiden gemeint ist.
Jenseits der Glastür drückt sich meine Tochter die Nase platt, mit gespitztem Mündchen, das offenbar „süüüß!“ intoniert, flankiert von einem Empfangskomitee, bestehend aus meiner Freundin Gaby sowie Rosi Semmler nebst Lebensgefährten, beides unermüdliche und redegewaltige Mitstreiter in Sachen Tierschutz. Dem langmütigen Gesichtsausdruck meiner Freundin entnehme ich, dass mindestens eine halbe Stunde Kommunikation mit den beiden hinter ihr liegen muss und dass sie den dringenden Wunsch hegt, mich zu fragen warum niemand sie auf dieses Erlebnis vorbereitet hat.
Und dann ist es soweit: mein Gepäck kommt und ich ziehe, die Hundetasche in der einen Hand tragend, mit der anderen den Trolley ziehend, starren Blickes Richtung Ausgang, hinzu auf die Zollbeamten, die mir einen flüchtigen Blick zuwerfen und der Tasche kein Augenmerk gönnen, vorbei an den Zollbeamten, hinzu auf die selbsttätige Tür und hindurch durch die selbsttätige Tür, die sich hinter mir schließt und eine kleine Hündin, die ich vor einer Woche auf einem Parklatz in Varna gefunden habe, in eine neue Heimat einlässt.

Dies war das riesigste Ungetüm, das ich je von innen gesehen habe und sein Bauch war voller Zweibeiner und als es zu rollen begann war es lauter als alle Ungetüme die jemals auf den Straßen an mir vorbeigedonnert sind, zusammen. In meinem Kopf hat es gedrückt und gepiept und ich fühlte mich so unbehaglich wie lange nicht mehr. Mir scheint, dass, außer ihren Nasen, auch die Ohren der Zweibeiner nicht sonderlich gut funktionieren, denn wenn sie freiwillig ein solches Getöse auf sich nehmen, kann es doch nur aus dem einen Grund sein, dass sie diesen grauenhaften Lärm nicht so deutlich hören können wie wir. Dann können sie aber auch keine Langschwänze hören, wenn sie unter der Erde herumflitzen. Vielleicht verstehe ich eines Tages, wie man ohne Nase und Ohren jagen und dennoch Beute machen kann.
Und dann kann ich endlich, endlich aus dieser engen Schachtel heraus und wieder auf meinen vier Pfoten stehen, wie es sich für einen anständigen Hund gehört und rings um mich herum sind Zweibeiner, die mich streicheln und mir Futter zustecken und das scheint mir doch darauf hin zu deuten, dass das hier gar kein so übler Ort ist, wenn ich auch ganz sicher noch nie hier gewesen bin. Und sie ist immer noch bei mir.
Aber ich muss noch einmal in ein rollendes Ungetüm steigen, in dem es ziemlich heftig nach meinesgleichen riecht, was mich etwas beunruhigt; doch diesmal muss ich in keine Schachtel, sondern darf ganz dicht bei ihr sitzen und wir rollen auch nicht lange.
Dann darf ich hinaus und ich hebe meine Nase hoch um Witterung aufzunehmen. Es ist ruhig und in der Dunkelheit hängt nur das große Licht hoch oben, dass wir vorhin, an dem rauschenden Wasser, zusammen betrachtet haben. Es sieht noch unverändert aus, aber sonst ist alles anders. Nichts riecht vertraut, kein Geräusch klingt bekannt; und anstelle des rauschenden Wassers liegt vor mir eine große Ebene, weiter als ich schauen kann; und hier vorne kann ich eine Menge Nachrichten erschnüffeln, was wohl heißen soll, dass es hier auch eine Menge Rivalen geben wird.
Zwei kommen tatsächlich gerade auf mich zu gerannt – nein, nicht auf mich, auf sie!
Oh nein, das passiert nicht, an sie kommt ihr nicht heran, wer immer ihr auch sein mögt und selbst wenn das hier euer Revier ist – sie ist meine Alphahündin! Und sie gehört mir!
Ich stelle mich vor sie und knurre die Neuen an, die verblüfft stehen bleiben; aber da beugt sie sich nieder und begrüßt die beiden und ich erkenne beschämt und verwirrt, dass sie zu ihr gehören, dass sie ihr Rudel sind, ebenso wie das junge zweibeinige Weibchen, das uns vorhin empfangen hat. Warum nur ist sie die ganze Zeit ohne sie herumgelaufen?
Und was bin ich nun? Gehöre ich auch dazu?
Ich beobachte die anderen beiden scheel und stelle fest, dass sie mich nicht anders ansehen; die kleinere zeigt mir sogar die Zähne. Freches Biest. Aber ich muckse mich nicht. Sie ist klein, aber sie ist eine Ältere und sie war vor mir da. Wenn ich ins Rudel will, muss ich hinten anfangen.
Wir erledigen unsere Geschäfte und dann gehen alle in Richtung des großen Hauses, das die beiden Älteren und das junge Weibchen ganz selbstverständlich betreten.
Ich bleibe stehen und blicke verzagt zu meiner Alphahündin auf.
Ich darf doch nicht...oder darf ich doch?
Sie fordert mich energisch auf einzutreten und ich flitze so schnell hinein, wie ich nur kann, bevor sie es sich anders überlegt, renne die Treppen hoch und hinein in meine neue Höhle.
Hier ist es warm und hell, da steht Wasser und ich bekomme Futter, nicht das zum Zerbeißen, sondern solches zum Schlingen und schlingen muss ich, denn da stehen die beiden Älteren und sehen fassungslos aus und die kleine Ältere würde mich gerne wegschubsen, aber es wird ihr nicht erlaubt. Dennoch: was ich im Bauch habe kann mir keiner mehr wegnehmen und mein Bauch ist ziemlich leer, also passt eine Menge hinein, sogar mehr als in meinem Napf ist, aber ich will mich nicht beschweren. Der Boden ist so weich, dass ich mich wohlig auf ihm wälze; aber da naht meine Alphahündin und ehe ich begreife was sie vorhat, sitze ich in einem riesigen weißen Bottich und sie lässt Unmengen Wasser auf mich fallen; dann schäumt sie mich wieder und wieder ein, was nicht besser stinkt als beim ersten Mal, und dann kommt wieder Wasser und noch einmal und noch einmal, bis sie endlich zufrieden ist. Das scheint ein unumstößliches Gesetz bei ihr zu sein, mir erst einmal meinen Geruch zu nehmen, den ich gerade mit knapper Not wieder erworben hatte. Das finde ich bedenklich, vor allem wenn ich feststelle, dass die beiden Älteren durchaus ihren eigenen Geruch haben. Aber sicher finde ich den Sinn des Ganzen noch irgendwann heraus und vielleicht gelingt es mir, beim nächsten Mal rechtzeitig zu verschwinden. Aber dann entdecke ich etwas, was mich alles andere vergessen lässt: da ist ein Lager, mit vielen weichen Decken und ich erinnere mich, dass ich schon einmal eines hatte, vor langer Zeit, als ich noch nicht verstoßen war.
Dort war mein Platz an dem ich schlafen durfte.
Nun habe ich wieder ein Lager und es ist warm und weich und es ist für mich. Ich springe hinein und rolle mich zusammen und kann endlich schlafen und ich habe endlich wieder ein Heim.

Ein neues Zuhause für einen Hund zu suchen, den man eigentlich behalten will, ist nicht unbedingt die leichteste Übung und genau genommen ein Ding der Unmöglichkeit.
Die Latte hängt so hoch, dass etwaige Bewerber mit ziemlich dünner Luft zu kämpfen hätten, wollten sie hinauf- geschweige denn hinüber kommen.
Und gänzlich übel wird die Sache, wenn der Hund unmissverständlich zu erkennen gibt, dass er ohnehin seiner Meinung nach bei der Endstation seiner Sehnsucht angekommen ist
Als Maika mit größter Selbstverständlichkeit in das Körbchen meiner beiden Hündinnen sprang, sich zusammenrollte und sofort einschlief, erweckte sie den Eindruck eines Schiffbrüchigen, der nach langer Irrfahrt auf einer Holzplanke treibend, endlich heimgefunden hat; ungläubig beäugt von Sisi und Lise, die daneben standen und zusahen, wie ihnen ihr Schlafplatz geraubt wurde. Sisi begab sich gramvoll ins Zimmer meiner Tochter ins Exil, während Lise, die sich normalerweise von nichts und niemandem die Wurst vom Brot klauen lässt, in mein Bett sprang, sich wutentbrannt durch den Kissenberg kämpfte um darunter auf Tauchstation zu gehen.
Die beiden waren zwar an vierbeinige Gäste gewöhnt, nicht aber an solche, die versuchten ihnen das Wasser abzugraben.
Maika respektierte zwar die Rangordnung; sie war die Jüngste und sie war neu, demzufolge hatte sie sich unterzuordnen. Aber sie schaffte es grundsätzlich, schneller als die anderen beiden neben mir auf dem Sofa zu sitzen, ihren Kopf in meinen Schoß zu legen und anbetend zu mir aufzublicken. Sie lief mir auf Schritt und Tritt hinterher und war offenbar der Ansicht nur dort glücklich sein zu können, wo der Abstand zwischen uns nicht mehr als zwei Schritte betrug und sie bemühte sich auf das Rührendste, nichts als Wohlgefallen zu erwecken. Ein bloßes „Pfui“ reichte aus um sie von jeder unerwünschten Handlung abzuhalten und selbst die uralte, halbverweste Mäuseleiche, die sie auf dem Feld gefunden hatte und hinunterzuwürgen versuchte, ließ sie auf meinen strengen Befehl hin los, wenn auch mit ratlosem Gesicht, als hätte sie Schwierigkeiten den Sinn einer solchen Vergeudung zu erkennen, da ich die Maus ja offensichtlich nicht selber zu fressen gedachte, was sie noch begriffen hätte, sondern wegwarf.

Als sie an Gewicht zulegte und ihr stumpfes Fell weich und glänzend wurde, kam, mit erwachenden Lebensgeistern, nach und nach ihr eigentliches Wesen zum Vorschein und ich erkannte plötzlich mit einiger Verblüffung, was mir zuvor überhaupt nicht aufgefallen war: dass ich einen Hund mitgebracht hatte, der zu 90 Prozent aus Jack Russel Terrier bestand. Bei den restlichen 10 Prozent schien ein Cocker mitgemischt zu haben, was sich vor allem in der unglaublichen Verwertung ihres Futters bemerkbar machte. Nach vier Wochen begann sie nämlich, trotz ausreichender Bewegung, Fett anzusetzen.
Der Jack Russel brach durch, als sie beim Spaziergang einen Hasen aufscheuchte; der Hase rannte los, der Jack Russel hinterher, völlig taub geworden für jegliches Rufen, Pfeifen und was einem entsetzten Hundebesitzer sonst noch so einfällt, wenn der Vierbeiner stiften geht und sich von einem folgsamen Haustier in einen Wolf zurückverwandelt.
Ich stand mit offenem, weil brüllendem Mund, starrte dem weißen Hund nach, der unaufhaltsam zu einem weißen, weit entfernten Punkt schrumpfte und dankte dem Heiligen Franz dafür, dass der arme Hase genug Verstand oder Erfahrung hatte, nach einem gewaltigen Spurt quer übers Feld, einen Haken zu schlagen und im rettenden Dickicht zu verschwinden, statt auf die Straße zuzuhalten.
Sisi und Lise saßen neben mir, in der befriedigten Haltung zweier Matronen, die genau solches Desaster hätten voraussagen können, sofern man sich der Mühe unterzogen hätte, sie zu befragen.
Maika rannte wie verrückt auf dem Feld umher, nach ihrer verschwundenen Beute suchend, möglicherweise in der noblen Absicht sie mir apportieren zu wollen, woran ich allerdings gewisse Zweifel hatte. Eine Möglichkeit wie diese, mir einen Jagdterrier mit nahezu unerschöpflichen Energiereserven und ebensolchem Eigensinn ins beschauliche Heim geholt zu haben, war mir nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte sie mehr oder weniger für ein liebebedürftiges Plüschtier gehalten, ein idealer Hund für gütige ältere Leute mit kleinem Vorgärtchen.
Solche arglosen Vorstellungen warf der weiße Blitz, der da hinten, ebenso taub wie abenteuerlustig, über den Acker wetzte, nunmehr vollständig über den Deich. Kein Sofakissen; dieser Hund wollte beschäftigt werden und er war außerordentlich gut zu Pfote, was die Aussicht, ihn baldigst gut vermitteln zu können, zu wenig mehr als einer vagen Möglichkeit gestaltete.
Maika war inzwischen vom Feld verschwunden und ins Dickicht eingedrungen; sie war nicht mehr zu sehen und kam ewig nicht wieder. Entweder hatte sie den Hasen gefunden, was ich nicht hoffen wollte, oder sie hatte die weggeworfene Mäuseleiche neu entdeckt und verspeist, oder, am wahrscheinlichsten, waren ihr die ungeheuren Jagdmöglichkeiten, die sich in diesem Gesträuch boten, aufgegangen und sie gedachte sie bis ins Kleinste auszuloten. Ich hatte keine Lust mir stundenlang am Feldrain die Beine in den Bauch zu stehen und machte mich auf den Heimweg, darauf vertrauend, dass ein Hund, der fähig war einer Hasenfährte zu folgen auch imstande sein würde allein zurück zu finden. Schließlich hatte er, unter weitaus schwierigeren Bedingungen, in einer verkehrsreichen Großstadt überlebt. Dies ist einer der hervorstechendsten Vorzüge von Straßenhunden, außer sozialem Verhalten, Anspruchslosigkeit und freundlichem Wesen: sie sind weitaus intelligenter und lebenstüchtiger als Haushunde, von denen selten mehr verlangt wird, als den Futternapf zu leeren, dreimal täglich ums Haus zu wandern, Unmengen kalorienreicher Belohnungshappen zu verdauen und sich den Neurosen ihrer Besitzer anzupassen.
Und damit nehme ich meine eigenen Hündinnen nicht aus, falls mich jetzt jemand beschimpfen möchte. Maika war ihnen haushoch überlegen, wie sie ja binnen einer halben Stunde nach ihrer Ankunft unter Beweis gestellt hatte.
Tatsächlich wartete sie am Gartentor auf uns, aufgeregt wedelnd und enthusiastisch hechelnd über ihren Ausflug berichtend, was für mich die Frage aufwarf, wie es ihr gelungen war uns ungesehen zu überholen. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft einer bemerkenswerten kleinen Hündin.
Es war unmöglich sie nicht zu lieben.


Damit befand ich mich in der Position von König Drosselbarts Prinzessin, der jeder Bewerber zu groß, zu klein, zu dünn, zu dick, zu arm, zu reich – kurz, rundum unzureichend erschien, womit sie natürlich nur bemänteln wollte, dass sie an einem Ehemann gänzlich uninteressiert war.
Ich stellte für mich selbst die Maxime auf, Maika nur herzugeben, wenn ich der festen Überzeugung war, dass es ihr woanders besser ginge als bei mir, womit ich mich rigoros geknebelt hatte.
Die Angebote die kamen, waren allerdings ohnehin nicht sehr überzeugend.
Eine Dame aus Mannheim, die meinte, dass Maika unbedingt ihrer Menagerie von vier Katzen, zwei Frettchen, zwei Hunden und etlichen exotischen Singvögeln in einer zweieinhalb Zimmer Wohnung hinzugefügt werden müsse, gleichzeitig vorsorglich erwähnend, dass sie sich keinen hohen Kaufpreis leisten könne; eine andere, die besorgt fragte, ob die einjährige Hündin nicht zu lauffreudig sei, da sie sonst nicht zu ihrem alten, gehbehinderten Rüde passe – als wären die Tierheime nicht voll mit älteren Hunden die dringend ein neues Zuhause brauchten; die Mutter, die ihrem nur vage interessierten zwölfjährigen Sohn ein Trostpflaster für die kürzlich erfolgte Scheidung und nunmehrige eigene Erwerbstätigkeit überstülpen wollte- „dann ist er beschäftigt!“ Mutter und Tochter, die über den Kopf des Vaters hinweg entscheiden und ihm den Hund einfach vor die Nase setzen wollten; die jüngst geschiedene Mutter, die – „demnächst“- mit ihrer Schwester ein gemeinsames Haus zu mieten gedachte und das vorhandene Kaninchen nicht für ein Problem hielt, weil es ohnehin immer im Käfig säße.
Solche Geschichten hatte ich schon einmal mitgemacht, als ich Misas Kinder unterbringen musste. Nur stand ich damals unter Zeitdruck und konnte es mir nicht leisten allzu wählerisch zu sein. Hätte ich es gekonnt, wäre Alina und Alkmene wahrscheinlich einiges erspart geblieben.
Diesmal hatte ich kein Zeitlimit und ich schwor mir, meinem Bauchgefühl die absolute Priorität einzuräumen. Mein einziges Problem hieß Sisi und Lise, die sich nicht mit der Konkurrenz anfreunden konnten und, je nach Naturell, gramgebeugt oder schlangengiftig reagierten. Vor allem Sisis Kummer setzte mir zu.
Niemand sollte um die Liebe seiner Mutter fürchten müssen, sei er zwei- oder vierbeinig. Dass diese Gefahr nicht besteht, kann man einem Hund schwer erklären. Wahrscheinlich auch sonst niemandem.
Und so vergingen drei Monate, bis sich die junge Frau Förster auf meiner Mailbox meldete und fragte, ob Maika noch zu haben sei.
Die Mail klang nett; sie erzählte von einem alten, geliebten Hund, der vor kurzem verstorben sei; von einem Bauernhof in Oberfranken, auf dem ein neues, kleines Einfamilienhaus stand, in dem die junge Familie – Tochter Franziska sei knapp 18 Monate – lebte; von einem Garten, der zwar umzäunt, aber sonst noch nicht weiter bewirtschaftet sei –„aber das kann ja Maika dann übernehmen!“; davon, dass immer jemand zu Hause sei, notfalls käme die Mutter herüber, für den Fall, dass Maika nicht allein bleiben könne; und dass Maikas Foto und ihr Schicksal, das sie im Internet gefunden habe, ihnen ans Herz gegangen sei. Sie würden ihr gern eine neue Heimat geben. Es kam ein Foto der kleinen Familie und eine Luftaufnahme des Anwesens: ein kleiner Weiler, bestehend aus gerade mal fünf Höfen, inmitten einer umwerfenden Landschaft aus Wäldern und Wiesen.
Wir mailten hin, wir mailten her. Wir sprachen am Telefon. Der gute Eindruck blieb. Mein Bauch sagte ja. Mein Verstand sagte ja. Meine Tochter sagte auch ja.
Mein Herz sagte nein.
Eigentlich sollte das Herz die Majorität haben, unabhängig von den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen. Aber allzu häufig sind Herzensentscheidungen egoistisch und wollen besitzen und festhalten, weil Verlust und verlieren dem Herzen weh tut.
Maika war „mein“ Hund geworden und ich hatte sie lieb. Allein der Gedanke mich von ihr zu trennen hatte etwas Unerträgliches. Und was sie anging, war ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass sie nichts anderes sein wollte als „mein“ Hund. Und das wollte sie, seit ich sie auf dem Parkplatz in Varna auf den Arm genommen hatte. Aber sie wollte mein alleiniger Hund sein, gegen alle Ansprüche der beiden alten Mädchen mit ihren grauen Schnauzen und trübe werdenden Augen, die seit neun und zehn Jahren meinen Wegen folgten und die nun immer mehr von einer unternehmungslustigen und entzückenden jungen Hündin an die Wand gedrückt wurden. Unabhängig davon lebte ich in einer Mietwohnung und hatte die Erlaubnis darin zwei kleine Hunde halten zu dürfen. Zwei, nicht drei.
Und hier war ein Angebot, wie es eigentlich besser kaum sein konnte.
Ich schrieb erneut, machte meine Bedingungen klar, die denen entsprachen, die jedes Tierheim stellt: Kastration vor der nächsten Läufigkeit, keine Weitergabe an Dritte, sondern gegebenenfalls Rückgabe an mich, Familienanschluss und ausschließliche Haltung im Haus, Kaufpreis, etc.
Diese wurden sofort akzeptiert. Sie fragten mich nach ihrem bisherigen Futter, ihrem Schlafplatz, ihrer Halsbandgröße, all ihren Gewohnheiten und ich antwortete getreulich, dass es sich hier um einen absoluten Superhund mit ausgeprägtem Jagdtrieb handeln würde. Sie fanden es völlig in Ordnung und meinten dass das emsige Tier sicherlich genügend Platz und Möglichkeiten finden würde seinen Vorlieben zu frönen; ihnen würde ausreichend Land gehören.
Da mir kein weiteres Schlupfloch mehr blieb, teilte ich mit, dass ich Maika selbst zu ihnen bringen würde, allerdings erst in vier Wochen, denn sie war gerade läufig geworden und machte jedem Rüden schöne Augen, der jemals an unserem Gartenzaun das Bein gehoben hatte. Sie waren auch mit dieser Wartezeit einverstanden und ich begriff, dass unsere gemeinsame Zeit ein endliches Ziel bekommen hatte: den 1. Februar 2004.

Manchmal ist es sicherlich besser wenn man nicht weiß, wie nahe der Abschied ist, vor allem dann, wenn man keine Ahnung hat, wie man sich darauf vorbereiten soll. Statt mich innerlich nach und nach zu distanzieren, was möglicherweise hilfreich gewesen wäre, ließ ich mich immer mehr auf meine kleine Straßenhündin ein, während sie ihrerseits immer anhänglicher, immer liebebedürftiger wurde, vielleicht weil sie meinen Konflikt spürte und ihre unsichere, von mir abhängige, Existenz bedroht fühlte.
Noch drei Wochen – ihre Läufigkeit gerät in das Stadium, wo nur noch Leinenzwang angesagt ist, dem sie sich ergeben, aber höchst lustlos fügt.
Noch zwei Wochen – sie tänzelt mit seitlich gedrehtem Schweif verführerisch an jedem Rüden vorbei, der, sofern er nicht flugs an die Leine gelegt wird, der nicht misszuverstehenden Aufforderung augenblicklich Folge zu leisten wünscht.
Noch eine Woche – der Läufigkeit aufregendste Phase ist vorbei, der Schwanz wird wieder ordnungsgemäß getragen und das Wetter schlägt um. Schneefall setzt ein.
Wenn es heftiger schneit kann ich nicht fahren. Mit meinen Sommerreifen kann ich vielleicht durch Berlins Straßen schlittern, aber nicht über oberfränkische Berge. Jeder rät mir davon ab. Ich rate mir selbst davon ab. Natürlich.
Frau Förster beruhigt mich. Ihr Bruder hat auch nur Sommerreifen und fährt jeden Tag 20 km zur Arbeit; die Straßen sind frei. Außerdem ist Wetterumschwung angesagt; am Wochenende soll es warm werden. Tauwetter.

Noch ein Tag – wir machen einen letzten Kontrollbesuch beim Tierarzt. Sie ist in bestem Zustand; der eingepflanzte Chip ist lesbar, das Fell ist dicht, glänzend und ungezieferfrei, Gebiss, Augen, Nase, Herztöne, Impfungen – alles in Ordnung. Ein Bilderbuchhund.
Nur mein Herz spielt verrückt.
In der Nacht bricht Sturm los, der am Morgen zwar zu lediglich böigem Wind abgeflaut ist, aber dennoch nicht eben ideales Reisewetter verheißt. Aber der Schnee ist tatsächlich weg, die Temperatur deutlich angestiegen und die erste Frühlingsahnung liegt in der Luft.
Die Elemente haben gesprochen. Ich werde fahren.

Wieder einmal hat sie mich in ihr rollendes Ungetüm gesetzt und diesmal rollen wir sehr lange und auch sehr schnell. Ich versuche erst gar nicht, zu ihr nach vorne zu kommen, denn sie wird es nicht erlauben. Ich würde gerne bei ihr sitzen, denn ich spüre, dass etwas geschieht und es würde mir besser gehen, wäre ich nah bei ihr. Sie hat meine Schlafdecke mitgenommen, also soll ich wohl hier schlafen. Ich wünschte ich könnte verstehen was das alles zu bedeuten hat. Ich spüre dass sie Kummer hat und ich würde gern meinen Kopf in ihren Schoß legen, weil es sie vielleicht trösten würde. Aber ich darf nur still auf meiner weichen Schlafdecke liegen und sie nicht stören, während sie das Ungetüm bewegt. Ich habe keine richtige Angst, aber ich fühle mich beklommen, weil ich nicht verstehe was geschieht und weil ich ihre Trauer spüre. Manchmal schlafe ich ein, weil ich nichts anderes zu tun habe.
Ich wünschte ich wäre nicht hier. Ich wünschte, ich könnte, wie sonst, auf der großen Ebene herumjagen, nach Langschwänzen schnüffeln und den Langohren hinterher rennen. Selbst die beiden Älteren wären mir recht. Aber sie hat nur mich mitgenommen. Nur mich. Und die Schlafdecke.
Einmal hält sie an, gibt mir zu trinken, lässt mich mein Geschäft erledigen; und wieder einmal bin ich an einem gänzlich unbekannten Ort. Dort drüben rasen rollende Ungetüme vorbei, mit einem Höllenlärm und ich bin froh nicht hier bleiben zu müssen, wieder einsteigen zu dürfen.
Wohin rollen wir?
Sie hält noch einmal an, aber wieder nicht an unserem Zuhause. Sie läuft eine Weile mit mir durch einen unbekannten Wald und scheint nicht zu bemerken, dass es in Strömen gießt, was sie sonst nicht besonders leiden kann. Hier riecht es zwar sehr aufregend, aber sie hält mich an der Leine, also kann ich nicht viel untersuchen. Und dann geht es wieder weiter, bis zum nächsten Halt. Dort treffen wir ein zweibeiniges Weibchen, das mich liebevoll streichelt, was ich mittlerweile gewöhnt bin, denn ich treffe nur noch auf freundliche Zweibeiner, die mich kraulen und mir Futter zustecken, als wären all die prügelnden, tretenden und Steine werfenden Zweibeiner in einer anderen Welt zurückgeblieben. Ich bin nie wieder einem begegnet, seit sie mich aufgenommen hat.
Das andere Weibchen steigt in ihr eigenes Ungetüm und rollt davon. Wir folgen ihr offenbar, denn beim nächsten Halt sehe ich sie wieder. Aber ich sehe noch etwas anderes, weitaus Interessanteres: kleine, braune Geschnäbelte, die herumgackern und nur darauf warten, dass ich mich mitten unter sie stürze. Aber meine Alphahündin verdirbt mir heute jeden Spaß; sie leint mich an und ich habe nur die Genugtuung zu sehen, dass allein mein Anblick ausreicht die Gackerer in die Flucht zu schlagen. Dann werde ich hinter einen Zaun gezogen und kann nichts mehr unternehmen, denn sie sind auf der anderen Seite. Und der Zaun ist dicht, wie ich sofort untersuche. Aber vielleicht ergibt sich noch eine Gelegenheit.
Hier ist zunächst einmal wieder ein Haus; und ich darf hinein. Und dort drinnen stehen tatsächlich zwei Schüsseln, eine voller Wasser, die andere voller Futter.
Ich nehme Witterung auf, aber es riecht nicht aktuell nach einem Rivalen. Ich kann zwar einen Geruch auffangen, aber er ist alt und schwach, wie eine ferne Erinnerung.
Hier ist niemand außer mir. Das heißt, das Futter das da steht, ist für mich – großartig! Bedauerlicherweise nimmt mir mein Alphaweibchen einen großen Teil weg. Aber der Rest ist auch noch ausreichend. Einen Schlafplatz sehe ich auch; sogar meine Decke liegt bereits darin. Aber geschlafen habe ich heute schon genug. Ich untersuche meine Umgebung: alles fremd, alles neu, aber nicht Beunruhigendes. Da draußen sieht es interessanter aus, aber ich kann nicht hinaus, obwohl die Tür durchsichtig ist. Ein männlicher Zweibeiner kommt herein und er trägt ein Junges auf dem Arm. Er begrüßt mich freundlich und legt das Junge auf die Erde, weil es offenbar noch nicht auf zwei Beinen laufen kann. Ich nehme den Welpengeruch auf und beschließe Toleranz zu üben. Zweibeinige Jungtiere sind manchmal unberechenbar und dann tut man gut daran, nicht in ihrer Reichweite zu sein. Aber dieses hier ist noch nicht schnell genug für mich.
Irgendwann erkennen alle, dass es da draußen bedeutend unterhaltsamer ist, als hier drinnen, also darf ich endlich hinaus und mir die Pfoten vertreten. Die Geschnäbelten rennen wieder gackernd auf und davon und ich zerre jaulend an der verflixten Leine, aber man lässt mich nicht los. Doch diese Gegend hat unbestreitbare Vorzüge: ich höre Langschwänze unter der Erde huschen und offensichtlich sind sie in keiner Weise auf mich vorbereitet. Den ersten Langschwanz erwische ich nach wenigen Schritten und es ist ein äußerst fettes und saftiges Exemplar, bedeutend besser ernährt, als ich es gewöhnt bin. Dies scheint eine gute Gegend zu sein. Und Konkurrenz sehe ich weit und breit nicht.
Das heißt, alles was hier herumrennt gehört mir!
Ich habe noch kaum den ersten verdaut, da tut schon der nächste seinen letzten Quiekser.
So wie es aussieht werde ich hier bestimmt keinen Hunger leiden.
Werden wir hier bleiben?
Hier ist ein guter Platz.

Ich sah die Hühner und nahm Maika geistesgegenwärtig noch im Auto an die Leine. Sie hatte sie ebenfalls entdeckt und leckte sich begeistert die Lefzen, sprang aus dem Wagen und stürzte sich mit Halali auf das davon stiebende Federvieh, bis die Leine ihren Mordabsichten Einhalt gebot. Dann tanzte sie wütend jaulend auf den Hinterbeinen, bis ich sie energisch hinter dem Gartenzaun verstaut hatte, den sie ohne weiteres Säumen erfolglos nach Löchern untersuchte. Der Garten befand sich tatsächlich noch im Urzustand und umrahmte das hübsche Einfamilienhaus, das auf dem Scheitelpunkt des Hügels stand, während sich zu seinen Füßen das Maintal erstreckte.
Ich nahm das Postkarten-Panorama in mich auf und gestand mir seufzend ein, dass ich nichts dagegen einzuwenden hätte, mich zusammen mit Maika hierher adoptieren zu lassen.
Die letzte Strecke, nachdem Frau Förster uns am verabredeten Treffpunkt abgeholt hatte, gemahnte an eine Reise ins Märchenland: über die sieben Berge, hin zu den sieben Zwergen. Es ging immer höher hinauf und der Ausguck auf weite Täler, saftige Wiesen und schweigende Wälder war bilderbuchmäßig. Ich sagte mir zwar, dass ein schöner Ausblick von der morgendlichen Frühstückstafel nicht unbedingt Priorität in Hundeaugen besitzen muss. Aber gemessen an dem, was sich hier bot konnte unser, beklagenswert zugemülltes, Feld keinesfalls Schritt halten. Für eine Großstadtpflanze wie mich, deren Kindheitserlebnisse in unverfälschter Natur an Omas Schrebergartenzaun geendet hatten, war es paradiesisch.
Meine Tochter würde es garantiert anders sehen: „Und was soll ich hier tun? Rüben ernten? Sterne zählen? Keine Oberschule in der Nähe, die Disco 20 Kilometer entfernt und der Bus fährt zweimal am Tag! Hier könntest du Massenmord begehen und keiner würde es merken! Vielen Dank, mir reicht schon Großziethen!“
Wir leben fünf Fußminuten vor den Mauern Berlins, falls nun jemand annehmen sollte, mein Kind wäre in einer Wüstenoase begraben.
Im Inneren des Hauses herrschte jene blitzende Sauberkeit, die ich so oft kopieren wollte und nie erreicht habe, aus welchen Gründen auch immer. Auch andere Familien haben Kinder und Haustiere, die fünf Minuten nachdem man gewischt hat, Sand, Lehm und Schlimmeres herein schleppen. Aber mein Haushalt scheint der einzige zu sein, dem man es ansieht.
Zumindest der einzige den ich kenne.
Ich bemerke, dass alles für Maikas Empfang bereit ist. Dort steht das Körbchen, in das ich ihre Decke lege, dort warten zwei gefüllte Näpfe darauf, dass sie sich bedient, wobei ich aus dem randvollen Fressnapf gerade noch rechtzeitig die Hälfte wieder herausklauben kann, mit Hinweis auf des Tieres rundliche Taille. Der Familienvater erscheint, Baby Franziska auf dem Arm, dass ein ausnehmend friedliches und freundliches Wesen zu sein scheint, abgesehen davon, dass es allerliebst aussieht. Ich hatte mir ein paar Sorgen wegen des Kleinkindes gemacht; nicht deswegen, dass Maika ihm etwas antun könnte, denn sie mochte Kinder, sondern umgekehrt. Aber in dieser Familie spüre ich Tradition, was nicht darauf hin deutet, dass man einem Erziehungsstil huldigt, der Eltern enge Grenzen und Kindern überhaupt keine setzt.
Sie laden mich zu Kaffee und – natürlich – selbstgebackenem Kuchen ein, dem ich tapfer zuspreche, weil mir nach sechsstündiger Fahrt der Magen hängt, bereden dabei alles, was für die Zukunft noch wichtig sein könnte, erledigen die Formalitäten und machen uns dann zu einem Spaziergang auf – für sie der erste mit ihrem Hund, für mich der letzte mit einem Hund, der nun nicht mehr mir gehört.
Die Sonne kommt heraus, Baby Franzi wird in den Buggy gesetzt, Maika an die Leine genommen, wogegen sie schnaubend und senkrecht stehend protestiert, als sie wieder der Hühner ansichtig wird, und dann geht es hinaus aufs Feld. Ich übergebe Frau Förster die Leine, während ihr Ehemann den Buggy schiebt und stopfe meine untätigen Hände in die Jackentaschen, während ich neben den beiden einherstapfe, mich auf den unvermeidlich näher rückenden Abschied vorbereitend, ohne indes zu wissen, wie ich das anstellen soll. Als Maika eine Maus fängt starren wir sie mit den unterschiedlichsten Gefühlen, an, fühlen ins jedoch nicht berufen ihrem Festschmaus Einhalt zu gebieten. Dem armen Nager hätte eine Intervention ohnehin nicht mehr geholfen; ihre Straßentierzeit hat Maika gelehrt zu würgen und zu schlingen, was das Zeug hält. Mir wird jetzt auch klar, wie sie überhaupt hatte überleben können. Sie lässt nicht mal den Schwanz übrig.
So gesehen ist der Spaziergang ein voller Erfolg. Maika sieht einen Acker voller ungeahnter Fress- und Jagdmöglichkeiten und somit die erfreulichsten Zukunftsperspektiven vor sich. Ihre neuen Besitzer finden sie offenkundig hinreißend und in ihren Fähigkeiten Mäuse zu fangen einen zusätzlichen Gewinn. Ich habe das Gefühl, genau den richtigen Platz für sie gefunden zu haben, inbrünstig betend, dass es sich auch für die Zukunft als solcher erweisen möge. Ein Hundeleben ist lang und nicht immer halten die guten Absichten mit der Länge eines solchen Lebens Schritt.
Dies muss sich immer erst zeigen.
Maika frisst noch eine weitere Maus, die auf das Auftauchen eines Killers in ihrem beschaulichen Revier nicht vorbereitet war, dann machen wir uns auf den Rückweg und ich gehe daran von ihr Abschied zu nehmen.
Ich nehme sie auf den Arm, und wie vor fast genau vier Monaten, legt sie ihren Kopf, in einer für sie typischen Geste vollständigen Vertrauens, an meine Schulter, als sei hier der Ort an dem sie bleiben wolle. Ich streiche über ihre schwarzen Samtohren, feststellend, dass die fünf Kilo, die sie den damals vorhandenen dreieinhalb Kilos inzwischen hinzugefügt hat, nicht ohne gewichtige Auswirkungen geblieben sind und hoffe man achtet darauf, dass sie kein Fettwanst wird.
Ich sage ihr, dass ich gehen müsse, aber irgendwann zurückkommen würde, um sie zu besuchen; dass sie hier bleiben würde; dass hier nun ihr Platz sei.
Dann übergebe ich sie an Frau Förster und gehe hinaus ohne mich umzudrehen.

Sie hat mich wieder hochgenommen und ich glaubte, sie würde nun mit mir fortgehen, wie sie es bisher immer getan hat. Sie hielt mich fest und strich über meine Ohren und sprach leise zu mir. Dann übergab sie mich an das andere Weibchen und ging ohne mich hinaus. Ich war nicht sehr beunruhigt, denn fort gegangen ist sie schon öfter.
Aber sie ist immer zurückgekommen.
Um auf sie zu warten ist dies ein guter Ort. Hier ist keine Gefahr. Hier ist Freundlichkeit.
Ich bin nicht verstoßen worden. Ich habe einen warmen Platz zum Schlafen, ich habe Futter und Zweibeiner, die gütig sind. Das zweibeinige Weibchen ist auch eine Alphahündin. Das spüre ich. Sie wird mich schützen können.
Ich laufe zu der Tür hinter der sie verschwunden ist. Ich höre das Geräusch ihres rollenden Ungetüms und wie es sich entfernt, immer leiser wird und schließlich verstummt.
Sie ist fort.
Sie hat mich nicht verstoßen.
Aber sie hat mich verlassen.

Ich hatte in der nächsten Ortschaft übernachtet und meldete mich am nächsten Morgen nochmals telefonisch, um zu erfahren, wie die erste Nacht verlaufen sei.
„Ganz problemlos!“ erklärt Frau Förster. „Sie hat nicht geweint oder gejault, gar nichts. Sie war ein bisschen verwirrt, aber das war auch alles. Sie ist gekommen und hat sich reihum von allen streicheln lassen, davon kann sie ja überhaupt nicht genug bekommen. Und es findet sich immer jemand, der das übernimmt. Meine Mutter ist schon ganz vernarrt in sie. Sie ist wirklich nur lieb. Das mit den Hühnern haben wir geklärt. Besser gesagt, der Hahn hat es geklärt. Er ist auf sie losgegangen, da hat sie sich hinter mir versteckt. Jetzt ignorieren sie sich. Und die Vögel im Schlafzimmer lässt sie auch in Ruhe. Ich habe ihr gesagt, dass sie „Pfui“ sind. Das hat sie sofort verstanden. Wirklich, so ein lieber Hund. Ein richtiger Engel auf vier Pfoten. Danke, dass Sie sie uns gegeben haben.“

Nun denn. Eine bessere Nachricht hätte ich kaum erhoffen können.
Von einem schmutzigen Parkplatz in einer bulgarischen Hafenstadt in das dörfliche Idyll eines oberfränkischen Weilers. Von einem hungernden, verflohten, vertriebenen Straßenköter zu einer verhätschelten Einfamilienhaus-Prinzessin, die auf der Terrasse thronend ein immenses Revier überschauen darf. Von trockenem Brot und mageren Stadtnagern zu feinstem Futter und fetten Feldmäusen.
Was für eine Karriere! Obwohl sie nicht der erste Hund ist, der einen solchen Aufstieg hingelegt hat, erfüllt jedes gelungene Happy End doch immer aufs neue mit stiller Freude, auch wenn das Wissen um die vielen anderen Maikas, Misas, Roschkos und Boschkos, die weiterhin kein anderes Zuhause als die Straße kennen – in welchem Land auch immer – klarmacht, welch weiter Weg noch zu gehen ist.
Aber jeder gute Wald braucht Zeit um zu wachsen.
Ich schaue noch einmal zu den Hügeln hinüber, hinter denen mein kleines Mädchen nun leben wird, bevor ich den Motor anlasse um mich auf meinen langen Heimweg zu machen, immer noch unablässig die Frage im Kopf wälzend, ob ich richtig gehandelt habe. Mein Kopf sagt immer wieder ja, was mein Herz mit genau derselben Sturheit verneint.
Aber ich bin immer am besten gefahren, wenn ich auf meinen Kopf gehört habe. Mein Herz hat mich nicht selten in Sackgassen geführt, vor deren Mauern ich dann zu lange und zu ratlos gestanden habe.
Niemals sind wir so verwundbar, als wenn wir lieben. Vielleicht ist das Wissen darum die einzige Stärke, die dann noch bleibt.
Aus dem Autoradio ertönt Annie Lennox’ Ode, die einen kleinen tapferen Hobbit nach Westen schickt, zu den grauen Anfurten.
„...you have come to journey’s end…” Du bist am Ende deiner Reise angekommen...
„Hoffentlich!“ schluchze ich und gehe vom Gas, denn ein Tränenausbruch bei Tempo 140 könnte gut und gern auch zum Ende meiner Reise führen, also schleiche ich auf der rechten Seite weiter, nicht imstande den Sender zu wechseln und den Song abzuwürgen, der alles in mir hochkocht, was ich seit vier Wochen unter dem Deckel gehalten habe.
Ich hoffe, deine Irrfahrt ist nun auch zu Ende, mein kleiner Hobbit. Du hast einen langen und harten Weg hinter dir und du bist ihn klaglos gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr Hunde so etwas wie zurückschauen könnt oder ob ihr so glücklich seid, nur den Augenblick zu leben, wie er kommt.
Du wirst dich an mich erinnern wenn du mich wieder siehst. Selbst nach langer Zeit noch. Aber du wirst weder in der Vergangenheit leben, noch in der Zukunft, sondern nur in der Zeit die du hast, an dem Platz an den du nun gehörst.
Und dein Herz wird nicht schwer sein von Erinnerungen.
Ich wünschte, auch das meine wäre es nicht. Aber ich muss mein Menschsein tragen. Diese Bürde ist mir auferlegt, wie dir die deine und ob diese der meinen vorzuziehen wäre, in jeglicher Konsequenz, muss ich wohl bezweifeln.
Ich lebe nicht außerhalb von Zeit und Erinnerung, aber ich bin ihr auch nicht ausgeliefert.
Und vielleicht habe ich nun durch dich etwas Wichtiges und Entscheidendes erfahren, was zwar schon lange abstrakt in meinem Kopf gelebt hat, aber nie in meinem Herzen wurzeln konnte.
Dass Loslassen das wesentliche, das schwerste und das selbstloseste Element der Liebe ist.


War es immer schon so?
Ich liege vor meinem Heim in der Sonne und überschaue mein großes Revier. Dort unten gackern die kleinen Geschnäbelten. Sie haben einen Rudelführer der sie bewacht, also lasse ich sie in Ruhe. Die Langschwänze haben sich verzogen, was auch besser für sie ist. Außerdem bin ich satt.
Im Haus höre ich die Stimmen meines zweibeinigen Rudels.
Ich muss es beschützen.
Ich muss Bescheid sagen, wenn jemand kommt, der nicht hierher gehört.
Ich muss anschlagen, wenn ich Gefahr wittere.
Dafür beschützt es mich auch. So lautet das Gesetz.
Es gibt mir einen Schlafplatz und genügend Futter. Es lässt mich nicht allein, sondern ich darf überall bei ihm sein. Ich gehöre dazu.
War ich immer schon hier?
Mir ist als hätte ich auch einmal eine andere Welt gekannt, als wäre ich schon durch viele Welten gegangen und nicht immer waren sie gut. Aber das ist weit weg. Manchmal erwache ich wie aus einem entsetzlichen Traum und dann ist mir, als würde ich mit leerem, schmerzendem Bauch lange Straßen entlang rennen, verfolgt von Großen, die mir das Brot entreißen wollen, das mir ein zweibeiniges Weibchen zugeworfen hat. Als hätte ich nur eine kalte, dunkle Höhle zum Schlafen, in der ich nicht zur Ruhe komme, aus Angst vor den Großen oder männlichen Zweibeinern, die manchmal auftauchen und uns mit langen Stangen einfangen, an denen Schlingen hängen, die uns die Kehlen zudrücken, sodass wir vor Angst und Schmerz schreien und unser Geschäft verlieren.
Ich bin dann erleichtert, aufzuwachen und zu sehen wo ich mich befinde, dass ich auf meiner warmen Decke liege, dass ringsum alles ruhig und friedlich ist und dass mir keine Gefahr droht.
Dass ich in meinem Heim bin.
Da, wo mein Platz ist.

Kämpfen, Hoffen…
Gesendet: Freitag, 28. August 2009 22:47
Betreff: Post von Maika
Hallo Frau Rodrian,
heute habe ich leider keine guten Nachrichten für Sie. Maika ist sehr krank. Am Mittwoch musste ich sie stationär in der Tierklinik lassen. Ich war total verzweifelt, kann auch erst jetzt schreiben, wo ich wieder Hoffnung habe. Aber ich fange lieber von vorne an. Maika war die letzten 2 Wochen nicht in sehr guter Verfassung, sehr schlapp und abgeschlagen. Zuerst habe ich das auf die Hitze geschoben, aber nachdem sie jetzt fast nichts mehr gefressen hat und auch noch angefangen hat zu brechen habe ich einen Termin beim Tierarzt ausgemacht. Nach der Blutentnahme haben sie mir gesagt, dass Maika fast keine weißen Blutkörperchen mehr hat, das restliche Blutbild war auch etwas erniedrigt und die Nierenwerte sind katastrophal. Zuerst haben sie auf einen Tumor getippt, aber auf dem Röntgenbild und im Ultraschall war nichts zu sehen. Nun waren noch die Nieren oder die Bauchspeicheldrüse als Auslöser übrig. Der Tierarzt meinte das Maikas einzige Überlebenschance eine Bauchspeicheldrüsenentzündung sei und selbst dann wäre die Chance bei unter 50%. Ich war total fertig. Sie haben Maika sofort eine Infusion gelegt und Medikamente gegeben. Gestern hat er mir dann gesagt, dass die eingeschickte Blutprobe die Bauchspeicheldrüsenentzündung bestätigt hat, Maika ist stabil und bekommt weiter Antibiotika, er machte mir aber doch wieder etwas Hoffnung, sagt aber dass er keine Garantie geben kann. Am ersten Tag hatte er mir ja gesagt, dass Maika "todkrank" sei und ich mit meinem Herzen aber auch mit meinem Verstand entscheiden soll ob die immensen Behandlungskosten tragbar wären. Bei solchen Entscheidungen ist mein Verstand meinem Herzen meilenweit unterlegen. Heute hat mich der Tierarzt angerufen, mir ist das Herz schon in die Hose gerutscht als ich die Nummer auf dem Display gesehen habe. Aber die Nachricht gibt wieder neue Hoffnung. Die Nierenwerte haben sich wesentlich gebessert und somit kann eine Nierenerkrankung ausgeschlossen werden, die schlechten Werte kamen durch das Brechen und den damit verbundenen Flüssigkeitsverlust. Die weißen Blutkörperchen sind leider immer noch gleich schlecht, aber nach 1 1/2 Tagen kann man wahrscheinlich noch keine Wunder erwarten. Aber nachdem ich gesagt habe, dass ich Maika auf keinen Fall aufgebe, was es auch kostet, hat er mir gesagt, dass von Aufgeben keine Rede mehr ist, wir sind zwar noch nicht ganz um die Kurve, aber fast schon zur Hälfte. Am Montag findet die nächste Blutuntersuchung statt und ich Hoffe, nein ich bin mir sicher, dass die nächsten Nachrichten von mir dann schon viel positiver sein werden. Es tut mir leid Sie mit meinen Sorgen belasten zu müssen, aber da es um Maika geht haben Sie ja auch ein Recht auf die Informationen. Ich melde mich wieder sobald ich etwas Neues weiß.
Liebe Grüße
Elke Förster
… und verlieren…
Gesendet: Samstag, 29. August 2009 22:01
Liebe Frau Rodrian,
der Kampf ist vorbei. Ich habe meine Maika heute verloren.
Heute früh sah alles noch so gut aus, Maika war Gassi und hat einen stabilen Eindruck gemacht, ich hatte Hoffnung sie Dienstag oder Mittwoch wieder nach Hause holen zu können; dann kam um 17:30 völlig unerwartet der Anruf der Tierärztin, Maikas Zustand hat sich dramatisch verschlechtert, sie verliert Blut über Darm und Nase, sei zusammengebrochen und wir sollten sofort kommen, sie würde ihr weiteres Leiden gern ersparen. Ich war total entsetzt, wir sind sofort losgerast, aber als wir angekommen sind hat Maika zwar noch geatmet, aber ich glaube sie war schon sehr weit weg von uns und ihrem Leid. Sie hat kaum mehr reagiert als ich sie gestreichelt und mit ihr gesprochen habe.
Mir blieb nichts weiter übrig als einer Erlösung zuzustimmen und sie bis zuletzt zu halten damit sie spüren konnte, dass ich bei ihr bin.
Ich bin total verzweifelt, will nicht glauben was heute passiert ist, was soll ich jetzt machen, warum konnte ich nicht helfen, warum musste sie so früh gehen, warum??? Mein Engel ist mir davongeflogen und ich verstehe es nicht. Wir haben sie an ihrem Lieblingsplatz im Garten beerdigt. Aber es ist alles noch nicht real, ich hoffe immer noch auf einen bösen Traum. Ich danke Ihnen, dass Sie mir diesen Engel anvertraut haben, leider war meine Zeit mit ihr zu kurz. Ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme und ich weiß, dass Sie mit Ihren Gedanken und mit Ihrem Herzen immer bei Maika waren. Jeder Hund ist einmalig aber Maika war etwas ganz Besonderes für alle, die sie kennen lernen durften. Leider hat all unser Hoffen und Beten nicht geholfen und ich weiß nicht wie es jetzt weitergehen soll. Ich kann Ihnen nur noch einmal für alles danken und wünsche Ihnen und Ihren Schützlingen trotzdem alles Gute.
Liebe Grüße
Elke Förster

2011
Noch immer fühle ich mich schuldig, weil ich ihren Ruf gehört aber nicht beachtet hatte – und auch nicht mein Versprechen sie einmal zu besuchen.
Ich dachte, es wäre noch soviel Zeit. Sie war doch noch so jung.
Anfang August 2009 befand ich mich in Sachsen zur Kur, und als die Heimreise anstand überlegte ich plötzlich, ob ich nicht einen Schlenker über Franken machen und bei ihr vorbeischauen sollte. Überdeutlich hatte ich auf einmal ihr Bild vor Augen und Sehnsucht sie wieder zu sehen – aber ich fuhr nicht. Es war doch ziemlich weit für einen „Schlenker“ und ich hatte die Telefonnummer nicht, um mich anmelden zu können… ich fuhr nicht.
Bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen spielt die Zeit eine große Rolle – spät erkannt bedeutet in aller Regel: „zu spät“.
Vielleicht hätte ich drei Wochen vor der Katastrophe bemerkt dass ihre Schwäche nicht durch die Hitze verursacht wurde, sondern dass sie krank war – als Außenstehende hätte ich es eher merken können. Vielleicht wollte sie es mir sagen. Vielleicht hätte es sie retten können.
Vielleicht hat sie auch Leb wohl gesagt – denn sie hatte mir etwas gesagt, das wusste ich nun.
Sie ist höchstens sieben Jahre alt geworden – wenn überhaupt so alt -, sie hatte fünf Jahre lang ein Traumzuhause und sie hätte es noch länger haben sollen. Noch viel länger!
Sie liegt nun an dem Platz begraben, der ihr Platz gewesen war - auf dem Scheitelpunkt des Hügels, das Maintal zu Füßen – von dem aus sie in den fünf Jahren mit größter Treue und Entschlossenheit ihren Hof, ihr Heim und ihre Familie bewacht hatte. Dort hatte sie stets gelegen und ihr großes Revier überschaut – und dort ist nun auch ihr letzter Platz.
Als man sie zur ewigen Ruhe legte erschien ein gewaltiger Regenbogen, groß und leuchtend, über dem Tal.
War es ein letzter Gruß von ihr? Eine Botschaft der Liebe und des Trostes? Es würde zu ihr passen, denn sie hatte immer alles gegeben – und sie gab es nun über den Tod hinaus.
„Kurz bevor wir sie begraben haben gab es bei uns einen Gewitterschauer und ich dachte mir, dass jetzt der Himmel auch mit uns weint, weil wir unser Mädchen verloren haben, aber dann sah ich einen wunderschönen Regenbogen und ich wusste, dass mein Schatz jetzt in eine bessere Welt geht, ganz ohne Schmerz und Kummer. Das gab mir etwas Hoffnung und ich wusste, dass es nur ihre sterbliche Hülle war, die sie uns zurückgelassen hat; ich weiß, dass es die Regenbogenbrücke wirklich gibt, ich habe sie gesehen.“
Das schrieb mir Frau Förster – der ich unendlich mehr zu danken hatte, als sie mir.


Schlaf wohl mein kleines Mädchen.
Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen
den wünsche ich dir.
Und den Frieden der schweigsamen Erde.
Irischer Segensspruch
Und die Sonne trug Trauer, vom Himmel fielen Tränen,
der Wind schwieg und die Tiere verstummten,
denn es war ein Engel, der in Liebe starb.







































